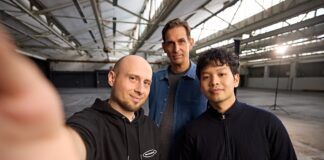Ayunis digitalisiert Verwaltungen mit intelligenten KI-Lösungen und macht Prozesse in Städten und Kommunen einfacher, schneller und effizienter.
Herr Michel, Ayunis hat seinen Umsatz innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt und das Team massiv ausgebaut. Was waren die entscheidenden Faktoren für dieses schnelle Wachstum?
Dieses schnelle Wachstum war nur möglich, weil wir Fokus, Kundennähe und Produktklarheit konsequent verfolgt haben. Erstens: Wir haben unser Ideal Customer Profile (ICP) geschärft und konzentrieren uns klar auf Kommunen und Landkreise. Zweitens: Ein dediziertes Customer-Success-Team aktiviert und betreut Bestandskund:innen, denn ein großer Teil unseres Neugeschäfts entsteht über Empfehlungen. Drittens: Wir haben mehr Produktklarheit und eine Zwei-Säulen-Strategie.
Die erste Säule sind unsere neuen KI-Produkte Ayunis Core, als Open-Source-KI-Plattform, und Ayunis Studio mit Agents zur Beschleunigung von Antragsverfahren. Und unsere zweite Säule Locaboo, unser etabliertes Fachverfahren für die Verwaltung von Liegenschaften wie Sport- und Kulturflächen. Das Vertrauen von inzwischen über 700 Kommunen macht Locaboo zum Türöffner: Aus diesen Beziehungen entstehen kontinuierlich warme Intros und Empfehlungen, die den Roll-out von Core und Studio beschleunigen. So verstärken sich beide Säulen gegenseitig und wir konnten unser bestehendes Kundennetz gezielt für eine breitere Positionierung nutzen.
Welche besonderen Herausforderungen bringt das Arbeiten im GovTech-Umfeld mit sich, das ja oft als langsam und bürokratisch gilt?
Für mein Empfinden ist es gar nicht primär das Thema Ausschreibungen, das bremst. Natürlich ließe sich hier einiges verbessern – Stichwort Bürokratieabbau und höhere Vergabeschwellen. Und ja, es ist entscheidend, dass Pilotprojekte in den Regelbetrieb mit gesicherter Finanzierung überführt werden.
Die größere Herausforderung liegt jedoch im Spannungsfeld zwischen Politik und Wirtschaft. Oft versucht der Staat, digitale Lösungen selbst zu entwickeln, statt auf erprobte Angebote der Privatwirtschaft zu setzen. Das führt nicht nur zu kostspieligen Individualentwicklungen, die später als Millionengräber enden, sondern gefährdet auch private Initiativen und Start-ups, die in dieser Phase eigentlich schnell skalieren könnten.
Noch problematischer: Kommunen schalten häufig in eine Wartehaltung, sobald sie hören, dass das Land oder der Bund vielleicht eine eigene Lösung plant. In vielen Fällen passiert dann jahrelang nichts – oder das Ergebnis überzeugt am Ende nicht.
Wichtiger wäre es, Infrastrukturthemen zu zentralisieren, Daten- und Schnittstellenstandards verbindlich festzulegen und faire Rahmenbedingungen zwischen kommunalen IT-Dienstleistern und privaten Anbietern zu schaffen. Erst dann können Verwaltung und GovTech-Unternehmen wirklich effizient zusammenarbeiten.
Sie kommen ursprünglich aus dem FinTech-Bereich und haben dort auch Rückschläge erlebt. Welche Lehren haben Sie aus dieser Erfahrung gezogen und wie fließen diese heute in Ayunis ein?
Die Lehren sind sehr unterschiedlich. Erstens habe ich gelernt, wie entscheidend eine starke Unternehmenskultur ist. Sie entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Ein falscher Hire wirft dich Monate zurück oder kippt ein ganzes Projekt. Deshalb rekrutieren wir bewusst langsamer und nur Menschen, die unsere Kernwerte mitbringen und leben.
Zweitens hat mich das “Wirecard-Trauma” geprägt: Ich habe in der Phase der geplatzten Wirecard-Blase ein FinTech aufgebaut, das mit diesem Dienstleister zusammenarbeitete. Die Abhängigkeit von einem einzigen Partner war unser Todesstoß. Seitdem gilt: so wenig Drittabhängigkeiten wie möglich. Das klappt mal besser, mal weniger gut, fließt aber heute in jede unserer Entscheidungsabwägungen ein.
Inwiefern ermöglicht das GovTech-Umfeld aus Ihrer Sicht ein resilienteres Geschäftsmodell als der FinTech-Sektor?
Gute und berechtigte Frage. Natürlich könnte man meinen, dass auch wir im GovTech-Bereich stark von einer Kundengruppe abhängig sind – den Kommunen. Das stimmt formal, unterscheidet sich aber grundlegend von FinTech.
Im FinTech-Umfeld dominiert meist das B2C-Geschäft, wo die Zahlungsbereitschaft niedrig und die Wechselbereitschaft hoch ist. Kunden springen schnell ab, die Margen sind volatil und der Wettbewerb zuletzt brutal und oft nur mit viel Geld zu gewinnen.
Im GovTech dagegen treffen wir auf ein föderales System, das gar nicht die Kapazitäten hat, alle Digitalisierungsaufgaben selbst lösen zu können und das wissen die Kommunen sehr genau. Daraus entsteht ein struktureller, langfristiger Bedarf an verlässlichen Partnern, die begleiten.
Für uns bedeutet das: stabile, mehrjährige Verträge, hohe Planungssicherheit und ein sehr partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden. Wir verstehen uns als Mitgestalter der Staatsmodernisierung und genau diese Rolle macht das Geschäftsmodell deutlich resilienter als im FinTech-Sektor.
Warum ist GovTech heute kein Nischenphänomen mehr, sondern ein Bereich, der zunehmend an Bedeutung gewinnt?
Weil GovTech auf die zentralen Defizite der öffentlichen Verwaltung reagiert. Viele Behörden arbeiten noch mit papiergebundenen Verfahren und zersplitterter IT-Landschaft. Gleichzeitig wachsen Bürokratie und Fachkräftemangel, mit spürbaren Folgen für alle Bürger:innen und untergraben dadurch das Vertrauen in den Staat. GovTech-Lösungen setzen hier an und bringen mehr Tempo: Sie digitalisieren Antrags- und Freigabeprozesse, strukturieren unübersichtliche Datenbestände und ermöglichen Entscheidungen auf Basis belastbarer Nutzungsdaten zum Beispiel bei der Planung und Auslastung von kommunalen Einrichtungen. Zusammengefasst sorgen sie mit neuen Ideen und Technologien dafür, dass die Verwaltung schneller und moderner arbeiten kann.
Dadurch sinkt der Verwaltungsaufwand, Verfahren werden transparenter, und Mitarbeitende gewinnen Zeit für Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Politisch wächst zugleich der Reformdruck, hin zu moderneren Strukturen und einfacheren Vergaben.
Welche Rolle spielen Start-ups wie Ayunis für die digitale Souveränität Deutschlands?
Deutsche GovTech-Start-ups stärken die digitale Souveränität, weil sie sich vor Ort mit den Herausforderungen und Problemen der Verwaltung auseinandersetzen und für diese praxistaugliche Lösungen bereitstellen. Sie entwickeln in Deutschland betriebene, nachvollziehbare Systeme, die Datenschutz, IT-Sicherheit und Datenhoheit, durch offene Architekturen und Hosting in zertifizierten Rechenzentren, priorisieren.
Digitale Souveränität bedeutet dabei nicht ausschließlich Open Source, sondern auch die bewusste Stärkung deutscher oder europäischer Anbieter und die Nutzung der jeweils passenden Technologie. Ohne Hemmnisse durch aufwendige Vergaben und teils geschlossene IT-Märkte könnte das Potenzial noch mehr ausschöpfen. Der Staat muss sich hier noch mehr als Kunde verstehen und sollte bereits vorhandene Lösungen einsetzen, statt teure Eigenentwicklungen zu beauftragen.
Digitalisierung im öffentlichen Sektor gilt als Mammutaufgabe. Welche konkreten Beispiele können Sie nennen, bei denen Ayunis Verwaltungen bereits erfolgreich unterstützt?
Unsere Lösung Locaboo, mit der wir gestartet sind, unterstützt Verwaltungen in klar umrissenen Anwendungsfällen mit dem Ressourcenmanagement. Wir unterstützen über 700 Kommunen dabei, städtische Einrichtungen online mit sichtbaren Verfügbarkeiten zu buchen. Reservierung und Bezahlung erfolgen digital. Beispielsweise können in Lüneburg Musikschulräume samt Instrumenten zentral koordiniert werden, was die Auslastung verbessert. Straubing steuert Eis-, Hockey- und Mehrzweckhallen über ein nutzerfreundliches System, Trainings- und Spielzeiten sind transparent einsehbar. Übergreifend helfen Belegungssysteme und Nutzungsdaten, Engpässe zu vermeiden, Planung zu präzisieren und Entscheidungen belastbarer zu machen.
Für Verfahren mit vielen Unterlagen beschleunigt „Ayunis Studio“ die Bearbeitung, indem es Dokumente klassifiziert, Informationen extrahiert, Vollständigkeit prüft und fehlende Unterlagen automatisiert anfordert. „Ayunis Core“ integriert als KI-Assistenz einen Chatbot für Verwaltungsmitarbeiter in den Arbeitsalltag. Die Daten werden in deutschen Rechenzentren verarbeitet, personenbezogene Informationen bleiben geschützt und fließen nicht ins Modelltraining. Insgesamt reduziert das die administrative Last und macht Angebote für Bürgerinnen und Bürger einfacher zugänglich.
Wie gelingt es Ihnen, in einem traditionell trägen Marktumfeld Agilität und Innovationskraft einzubringen?
Indem wir Verfahren von den Nutzenden her neu denken und nicht nur analoges ins Digitale übertragen. Ziel ist, Komplexität zu reduzieren und Mitarbeitende zu entlasten. Dazu setzen wir auf schnelle, modulare Einführung: Lösungen werden an klar umrissenen Prozessen gestartet und Schritt für Schritt erweitert, mit kurzen Feedbackzyklen. Außerdem achten wir auf nachvollziehbare, souveräne Technik und offene Schnittstellen, damit sich Systeme integrieren und weiterentwickeln lassen.
Das Team ist von sechs auf 25 Mitarbeiter:innen gewachsen. Wie stellen Sie sicher, dass Unternehmenskultur und Strukturen mit diesem Tempo Schritt halten?
Wir rekrutieren über einen dreistufigen Hiring-Prozess an desen Ende ein Cultural-Teamfit steht. So stellen wir sicher, dass Kompetenzen und Werte zusammenpassen. Es kommt vor, dass Kandidat:innen denken, “das Schwerste” sei geschafft und dann genau dort ausscheiden. Klingt hart, würde ich aber jederzeit wieder so machen.
Außerdem haben wir früh starke Leads auf Schlüsselrollen gesetzt. Sie tragen Verantwortung, geben klare Orientierung und schaffen das stabile Fundament, auf dem wir das Team weiter aufbauen.
Welche strategischen Ziele verfolgen Sie für die nächsten Jahre – sowohl hinsichtlich Produktentwicklung als auch Marktpositionierung?
Wir nutzen den Rückenwind durch unsere KI-Integration. Diese kommt genau richtigen Zeitpunkt für die Verwaltungsdigitalisierung, und wir verankern sie noch tiefer in unseren Produkten. Konkret integrieren wir Automatisierung durchgängig, damit Prozesse spürbar schneller und verlässlicher laufen. Parallel entwickeln wir weitere moderne Softwarelösungen, die Verwaltungsmitarbeitende im Alltag entlasten.
Strategisch richten wir unsere Marktposition darauf aus, Vorreiter im GovTech-Bereich zu werden durch klare Spezialisierung, messbarer Nutzen für die Verwaltungspraxis und konsequente Produktfokussierung.
Welche Impulse wünschen Sie sich von Politik und Verwaltung, um GovTech-Start-ups noch stärker in der digitalen Transformation einzubinden?
Wir brauchen vor allem Tempo und klare Verfahren. Entscheidungswege sollten digital, schlank und iterativ ablaufen, damit erprobte Lösungen schneller in die Fläche gelangen. Vergaben müssen einfacher werden, Wertgrenzen für Direktaufträge an junge Anbieter steigen, und eine zentrale Stelle sollte Datenschutz und IT-Sicherheit zertifizieren, statt jede Kommune einzeln prüfen zu lassen.
Zweitens gilt es, IT-Märkte zu öffnen und zu konsolidieren. Ein transparenter, zugänglicher und zentraler Marktplatz für Bund, Länder und Kommunen sowie mehr Wettbewerb. Denn ein Marktplatz kann nur funktionieren, wenn es wenige, dafür aber sehr gute gibt. Statt Inhouse-Monopole zu erleichtern, schafft man so einen besseren Zugang für Start-ups und öffnet sich für Innovationen, die seit Jahren ausbleiben.
Drittens braucht es verbindliche Interoperabilität. Offene, standardisierte Schnittstellen nach bestehenden Spezifikationen müssen zur Regel werden. Wichtiger als Technologie-Dogmen ist, die passende Lösung einzusetzen. Open Source und proprietäre Ansätze können parallel bestehen.
Der Staat sollte als strategischer Kunde mit klaren Regeln, fairen Wettbewerbsbedingungen und einem Fokus auf nutzerzentrierte, skalierbare Dienste auftreten, um so die Souveränität durch den Einsatz eigener Unternehmen zu stärken.
Bild @Ayunis
Wir bedanken uns bei Andreas Michel für das Interview
Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder