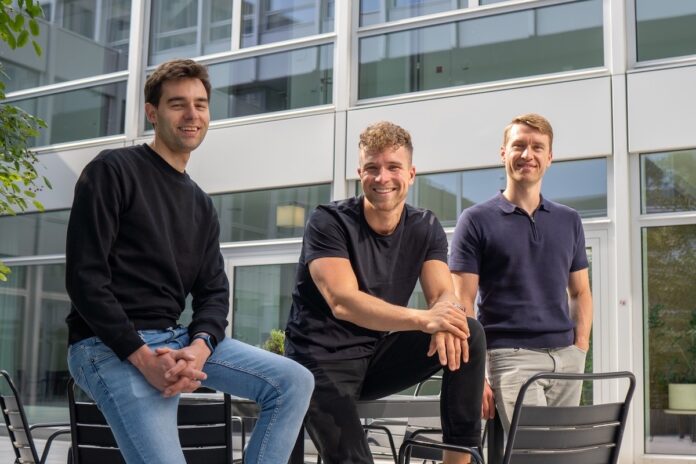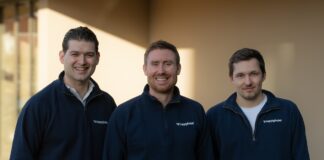Sectorlens entwickelt KI-gestützte Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, Softwareentscheidungen datenbasiert, transparent und strategisch fundiert zu treffen
Wie ist die Idee zu Sectorlens entstanden und wer sind die Gründer hinter dem Unternehmen?
In unserer Beratungspraxis haben wir über Jahre gesehen, dass selbst exzellent geführte Mittelstandsunternehmen mit weltweit führender Technologie immer wieder an einem Punkt scheitern: an internen Prozessen und IT-Systemen, die nicht zu ihrer tatsächlichen Geschäftstätigkeit passen. Nur rund 20 Prozent der KMU haben die Kompetenz, strategische IT-Entscheidungen eigenständig fundiert zu treffen – der Großteil sitzt damit in einer Entscheidungslage fest, aus der er ohne Unterstützung kaum herauskommt. Softwareauswahl war in diesen Projekten regelmäßig ein Engpass – teuer, langsam, wenig skalierbar und stark von Einzelmeinungen abhängig. Uns wurde klar: Wenn der Mittelstand digital nicht dieselben Werkzeuge bekommt wie globale Tech-Konzerne, entsteht ein struktureller Wettbewerbsnachteil.
Aus dieser Beobachtung heraus haben wir Sectorlens gegründet, um die Qualität professioneller Auswahlberatung breitenwirksam und ohne Beratungsbudget zugänglich zu machen. Unser Anspruch ist es, digitale Wettbewerbsfähigkeit nicht zum Privileg großer Player werden zu lassen. Sectorlens wird von einem interdisziplinären Gründerteam getragen: Tim Körppen verantwortet Softwarearchitektur und Entwicklung, Dr. Marcel Panzer bringt seine Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz (insbesondere Deep Reinforcement Learning) ein, und Dr. Benedict Bender ist für Strategie, Geschäftsmodell und Partnerschaften verantwortlich.
In Summe vereinen wir Domänenerfahrung aus der Industrie mit cutting-edge-KI-Forschung und operativer Umsetzung – mit dem Ziel, den Mittelstand zu den „industry leaders of tomorrow“ zu befähigen.
Was war der Auslöser, sich auf KI-gestützte Softwareauswahl zu spezialisieren – und wie hat sich daraus die Plattform Find-Your-Software entwickelt?
Aus den Projekterfahrungen ergab sich für uns eine Kernfrage: Wie machen wir hochwertige Softwareauswahl nicht nur für wenige Projekte verfügbar, sondern für viele Unternehmen gleichzeitig?
Klassische Auswahlberatung löst das Problem nur punktuell: teuer, langsam, schwer skalierbar – und immer mit begrenztem Erfahrungsraum. Selbst exzellente Berater sehen nur einen Marktausschnitt; Aktualität, Vergleichbarkeit und Breite sind zwangsläufig limitiert — allein im DACH-Raum existieren über 400 ERP-Lösungen, die in Projekten nie vollständig abgebildet werden können. Genau deshalb haben nur wenige Unternehmen Zugang zu fundierten Entscheidungen, obwohl der Hebel riesig ist.
Wir wollten dieses Nadelöhr auflösen und nicht zehn Unternehmen pro Jahr helfen, sondern zehntausend. KI war dafür kein „Trend“, sondern der einzige realistische Skalierungshebel, um Beratungslogik in Breite und Tiefe zu bringen – ohne Qualitätsverlust. Mit Find-Your-Software kombinieren wir reale Projekterfahrung mit neurosymbolischer KI, die Muster aus großen, heterogenen Daten lernt und zugleich erklärbar macht, warum eine Empfehlung entsteht.
Unsere Leitidee ist: Softwareauswahl soll für den Mittelstand so selbstverständlich möglich sein wie eine Google-Suche.
Welche Vision verfolgt Sectorlens im Hinblick auf die digitale Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen?
Unsere Vision ist, dass digitale Wettbewerbsfähigkeit kein Privileg der Big-Tech-Player bleibt, sondern ein erreichbarer Standard für jedes Unternehmen – unabhängig von Größe oder Budget. Software entscheidet heute darüber, wie schnell ein Unternehmen sich anpasst, skaliert und Wert schafft. Wenn Mittelstandsunternehmen mit Weltklasse-Produkten an internen Systemen scheitern, ist das kein individuelles Versagen, sondern ein strukturelles Marktproblem. Signavio beziffert die Opportunitätskosten aus Prozessineffizienzen auf etwa 4 Mio. Euro pro Jahr und Unternehmen – genau diese Verluste wollen wir reduzieren, indem wir den Zugang zu den richtigen digitalen Lösungen jedem Unternehmen möglich machen.
Wir adressieren dieses Problem, indem wir digitale Wettbewerbsfähigkeit für die Breite zugänglich machen – durch Entscheidungen auf Basis von Daten und Marktlogik statt Bauchgefühl. Unternehmen sollen genauso selbstverständlich zur passenden Lösung gelangen, wie sie heute eine Suchanfrage stellen – nur strategisch belastbar und kontextsensitiv zum Wettbewerbsumfeld.
Wenn wir unsere Vision erreichen, spielt der industrielle Mittelstand technologisch auf Augenhöhe mit globalen Big-Tech-Playern.
Wir wollen, dass der Mittelstand digital nicht aufholt, sondern internationale Wettbewerber aus eigener Stärke überholt.
Wie funktioniert die Kombination aus datengetriebenem Lernen und symbolischem Wissen in eurer neurosymbolischen KI konkret?
Man kann sich unsere KI als ein Ensemble aus zwei Intelligenzen vorstellen:
Die datengetriebene Komponente lernt aus großen, heterogenen Nutzungs- und Marktdaten, z. B. wo bestimmte Software in welchen Kontexten erfolgreich funktioniert – sie verhält sich wie ein Hypothesen-Generator, der Muster und Ähnlichkeiten über Unternehmen hinweg erkennt. Die symbolische Komponente fungiert als strukturierter Reviewer: Sie prüft diese Muster gegen explizites Domänenwissen, regulatorische Anforderungen und logisch ableitbare Geschäftsregeln und liefert damit eine begründbare Rechtfertigung, warum eine Empfehlung gültig ist.
Diese Kopplung ist entscheidend: Die KI kann nicht nur sagen, dass eine Lösung wahrscheinlich passt (Generalisation), sondern auch, warum sie passt und unter welchen Bedingungen (Justification). Beispiel: Für ein fertigendes Unternehmen kann das System erkennen, welche ERP-Lösungen in vergleichbaren Produktionsumgebungen stabil laufen, und zugleich nachvollziehbar begründen, dass etwa Produktionsfeinplanung (APS), Rückverfolgbarkeit oder Linien-/Losgrößen-Logik geschäftslogisch zwingend sind. So verhindern wir, dass Empfehlungen zwar statistisch plausibel, aber operativ nicht tragfähig sind – ein typisches Problem reiner Black-Box-Modelle.
Der genannte Fall ist exemplarisch: In der Realität kombinieren wir eine Vielzahl unterschiedlicher KI-Technologien innerhalb eines neurosymbolischen Ensembles, um in verschiedenen Daten- und Kontextlagen zu konsistent nachvollziehbaren Empfehlungen zu kommen – nicht nur „welche Lösung“, sondern „warum genau diese“ für genau dieses Unternehmen.
Für welche Zielgruppen ist Find-Your-Software besonders relevant und wie helft ihr ihnen, den Auswahlprozess von Unternehmenssoftware zu vereinfachen?
Find-Your-Software ist überall dort relevant, wo Softwareauswahl nicht als IT-Kauf, sondern als strategische Weichenstellung verstanden wird — also bei Unternehmen, die Digitalisierung nicht delegieren, sondern wettbewerbswirksam einsetzen wollen. Der zentrale Nutzen liegt darin, dass wir den Auswahlprozess von einem meinungsgetriebenen Projekt in einen daten- und kontextbasierten Entscheidungsprozess überführen: statt Bauchgefühl, statt „Best Guess“, statt monatelanger Analyse entsteht eine fundierte Empfehlung mit nachvollziehbarer Begründung.
Besonders spürbar ist das in Phasen, in denen Unternehmen wachsen, internationalisieren oder Komplexität reduzieren müssen — also dort, wo Software zur eigentlichen Stellschraube für Wettbewerbsfähigkeit wird. Entscheidungen, die früher Monate, interne Workshops und externe Beratung benötigten, lassen sich heute signifikant schneller, günstiger und mit höherer Sicherheit treffen — und das sowohl als Do-it-yourself-Variante als auch im kooperativen Modell mit Beratungen.
Dass auch Beratungen selbst unsere Engine nutzen, zeigt den zweiten Nutzen: Wir vereinfachen nicht nur die Auswahl, wir heben das Entscheidungsniveau — indem wir Marktwissen, Vergleichbarkeit und Begründbarkeit liefern, die in Einzelprojekten so nicht verfügbar sind.
Was unterscheidet euch von klassischen Software-Beratungen oder Vergleichsportalen?
Klassische Beratung behandelt Softwareauswahl als Projekt – Find-Your-Software behandelt sie als strukturierte, skalierbare Entscheidungslogik. Gute Beratungen können Anforderungen herleiten, aber immer nur im Einzelprojekt und mit hohem Zeit- und Kostenaufwand. Wir beginnen denselben Schritt früher – nicht manuell, sondern daten- und kontextbasiert und damit reproduzierbar.
Deshalb nutzen auch Beratungen unsere Engine: Sie kommen damit schneller, günstiger und mit höherer Begründungstiefe zu Ergebnissen – und sie können ihre Expertise dort einsetzen, wo sie Wert schafft, statt Analysearbeit zu wiederholen. Vergleichsportale liefern Listen, Beratung liefert Erfahrung — Find-Your-Software liefert die kontextbasierte, erklärbare Entscheidungslogik, auf der beide aufsetzen können.
Damit entsteht keine Konkurrenz zur Beratung, sondern eine neue Schicht im Entscheidungsprozess: Wir industrialisieren den Erkenntnisteil, auf dem Beratung und Management aufbauen.
Wie entstand die Idee zu Find-Your-ERP und welchen Mehrwert bietet das Tool gegenüber traditionellen Auswahlverfahren?
Find-Your-ERP ist die erste Domänen-Spezialisierung innerhalb unserer Plattform Find-Your-Software, die inzwischen auch Varianten wie Find-Your-HR und Find-Your-ESG umfasst. Wir haben mit ERP begonnen, weil die ERP-Wahl eine Wettbewerbsentscheidung ist, keine IT-Entscheidung. Sie definiert, wie Prozesse geführt, kontrolliert und skalierbar gemacht werden. Passt das System nicht zur Logik des Geschäftsmodells, entsteht Risiko – für das Projekt und für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Dass es über 400 ERP-Lösungen im DACH-Raum gibt, ist kein Zufall, sondern Ausdruck realer Vielfalt in Geschäftsmodellen und Prozessen: Ein ERP muss nicht „das beste“ sein, sondern das für den Einsatzzweck richtige.
Unser Ansatz verschiebt den Startpunkt: Statt vorauszusetzen, dass Unternehmen bereits wissen, was sie benötigen, rekonstruieren wir mit neurosymbolischer KI zunächst, warum bestimmte Anforderungen aus Geschäftsmodell, Prozessen und Wettbewerbsumfeld logisch folgen. Erst daraus entsteht eine begründete Empfehlung, die nicht nur „welche Lösung“, sondern „unter welchen Bedingungen“ trägt.
Der Mehrwert daraus ist dreifach:
• schneller, weil die Analyse nicht manuell, sondern vollautomatisiert erfolgt
• qualitativ belastbarer, weil Entscheidungen erklärt statt nur behauptet werden
• zugänglicher, weil dieses Niveau nicht länger Beratungsbudgets vorbehalten ist
Damit entsteht nicht einfach eine effizientere Auswahl, sondern ein demokratisierter, reproduzierbarer Entscheidungsstandard — der auch von Beratungen genutzt wird, um ERP-Projekte planbar und argumentierbar zu machen, statt sie als Risiko zu akzeptieren.
Welche Herausforderungen begegnen euch bei der Automatisierung komplexer Entscheidungsprozesse – und wie geht ihr damit um?
Die größte Herausforderung liegt weniger in der Technik als in der Natur der Entscheidung selbst: Softwareauswahl ist eine eingebettete Managemententscheidung — sie betrifft Strategie, Prozesse, Verantwortlichkeiten und oft auch Machtverhältnisse. Diese Dimensionen lassen sich nicht vollständig „automatisieren“, ohne sie vorher logisch strukturiert und erklärbar gemacht zu haben. Genau deshalb reicht eine rein datengetriebene KI hier nicht aus.
Die zweite Hürde ist nicht die Berechnung, sondern die Akzeptanz: Entscheidungen, die tief ins Unternehmen eingreifen, werden nur dann übernommen, wenn sie nachvollziehbar und anschlussfähig sind. Ein Black-Box-Modell wäre technisch möglich, aber organisatorisch wirkungslos.
Unsere Antwort auf beide Herausforderungen ist das neurosymbolische Prinzip: Wir automatisieren, wo Automatisierung zuverlässig trägt — und wir machen explizit nachvollziehbar, warum eine Empfehlung entsteht und unter welchen Bedingungen sie gültig ist. So wird nicht nur gerechnet, sondern eine Empfehlung entsteht, die im Unternehmen tatsächlich entschieden und umgesetzt werden kann.
Wie wichtig ist Transparenz für euch, wenn KI-gestützte Entscheidungen getroffen werden?
Transparenz ist keine Zusatzqualität, sondern eine Bedingung dafür, dass KI-gestützte Entscheidungen überhaupt übernommen werden. Gerade bei strategischen Weichenstellungen — wie der Wahl eines ERP-Systems — ist eine Empfehlung ohne nachvollziehbare Begründungslogik faktisch wertlos, weil sie weder akzeptiert noch verantwortbar ist. Genau an diesem Punkt scheitern viele KI-Anwendungen: Sie rechnen richtig, aber sie erklären nicht, warum.
Wir haben deshalb einen eigenen Transparency-Layer integriert, der jede Empfehlung nicht nur ausweist, sondern begründet und rückverfolgbar macht — inklusive Quellenbezug (z. B. Unternehmensangaben) oder logisch ableitbarer Anforderungen aus unserem Wissensgraphen. Nutzer können sehen, weshalb eine Anforderung berücksichtigt wurde und unter welchen Bedingungen sie gültig ist.
Unsere frühen Nutzerstudien haben eindeutig gezeigt: Ohne diese Nachvollziehbarkeit fehlt die Akzeptanz. Transparenz ist daher für uns kein ethisches „Nice-to-have“, sondern eine operative Voraussetzung für Adoption, Risikoübernahme und Entscheidungsfähigkeit.
Welche Entwicklungen oder neuen Anwendungen plant Sectorlens in den kommenden Monaten?
Wenn man Auswahl ernst nimmt, muss man den nächsten Schritt zwingend mitdenken: Eine gute Entscheidung entfaltet ihren Wert erst, wenn sie in Planung und Umsetzung übersetzt wird. Genau dort erweitern wir die Plattform — von der Auswahl hin zur aktiven Steuerung digitaler Wettbewerbsfähigkeit. Denn digitale Wettbewerbsfähigkeit ist kein IT-Thema, sondern ein Strategieproblem: Wir entwickeln Features, die nicht nur Systeme auswählen, sondern strategische Digitalpfade vorbereiten.
Wir entwickeln Funktionen, die aus dem Ist-Zustand eines Unternehmens nicht nur eine Empfehlung, sondern auch einen umsetzbaren Pfad ableiten: Welche Schritte priorisiert werden sollten, welche Abhängigkeiten bestehen und wie sich Entscheidungen gegenüber Management und Stakeholdern begründen lassen — automatisiert, datengestützt und im jeweiligen Wettbewerbsumfeld verankert.
Parallel öffnen wir weitere Softwaremärkte neben ERP, HR und ESG, sodass dieselbe Entscheidungslogik über Domänen hinweg angewendet werden kann. Zusätzlich arbeiten wir an Modulen, die automatisch Präsentationen, Entscheidungsunterlagen und strategische Szenarien generieren — damit Ergebnisse nicht nur richtig, sondern anschlussfähig sind.
Einige der kommenden KI-Features gehen noch einen Schritt weiter und schlagen auf Basis von Ist-Situation und Umfeldentwicklung konkrete Entwicklungspfade vor. Details folgen — aber das Zielbild ist klar: Wir bewegen uns von „Welche Lösung?“ hin zu „Wie steuert man digitale Wettbewerbsfähigkeit systematisch nach vorn?“
Wie beeinflusst die Auszeichnung beim Brandenburger Innovationspreis eure weitere Unternehmensstrategie?
Die Auszeichnung bestätigt uns vor allem darin, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Der Brandenburger Innovationspreis ist eine externe Bestätigung, dass der Ansatz — erklärbare KI für strategische Unternehmensentscheidungen im Mittelstand — nicht nur technologisch neuartig, sondern wirtschaftlich relevant ist.
Für uns bedeutet der Preis daher keine Kurskorrektur, sondern eine Validierung unserer Strategie: Wir fokussieren weiterhin auf digitale Wettbewerbsfähigkeit im deutschsprachigen Mittelstand und beschleunigen die Umsetzung genau in diese Richtung — bestärkt durch das Signal, dass wir mit diesem Ansatz nicht allein stehen, sondern als innovativ wahrgenommen werden.
Welche drei Ratschläge würdet ihr anderen Gründerinnen und Gründern geben, die datengetriebene Produkte aufbauen möchten?
Erstens: Wer datengetriebene Produkte baut, braucht früh eigene, differenzierende Daten. KI kann viel berechnen — aber ohne ein Datenfundament, das nicht kopierbar ist, bleibt jedes Modell austauschbar. Wir haben über Jahre Daten gesammelt, bevor sich der Vorteil zeigte — Daten sind kein Nebenprodukt, sie sind die Eintrittsbarriere.
Zweitens: Daten ohne Marktexpertise erzeugen keine Wirkung. Entscheidend ist nicht die Menge, sondern ob die Daten an reale Entscheidungen anschließen. Kooperationen und Feedbackschleifen — etwa über Formate wie den MediaTech Hub Accelerator — sind deshalb kein „nice to have“, sondern notwendig, um die richtigen Daten für das richtige Problem zu heben.
Drittens: Ein datengetriebenes Produkt darf nicht als Side-Project entstehen. Man muss am Markt bauen, nicht neben dem Markt — konsequent an realen Pain-Points ausgerichtet, nicht an abstrakten Möglichkeiten. Märkte lassen sich neu denken, aber sie verzeihen keine Produkte, die an ihrem Bedarf vorbeientwickelt wurden.
Bild Gründerfoto @ Isabelle Golz, Potsdam Transfer
Wir bedanken uns bei Karsten Birkholz und Guido Schumacher für das Interview
Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder