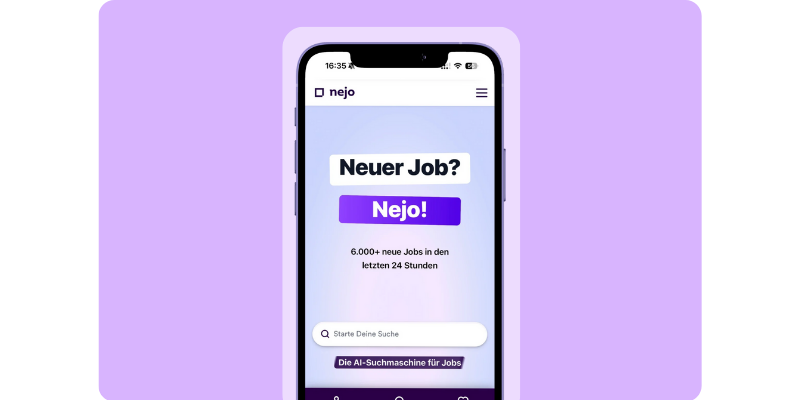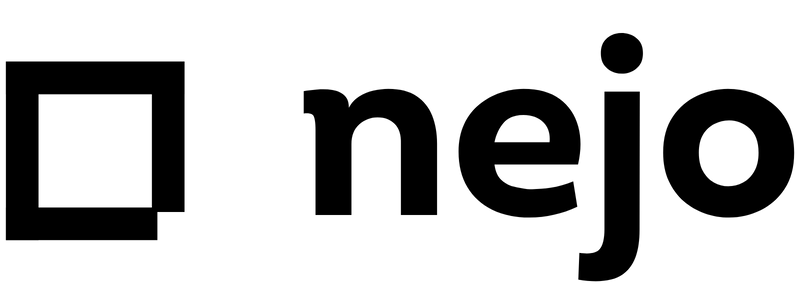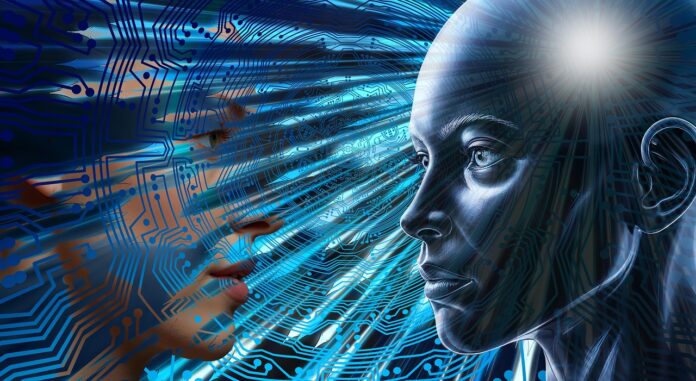Zenaris ermöglicht älteren und pflegebedürftigen Menschen durch eine innovative Fernsehlösung den einfachen Zugang zur digitalen Welt und stärkt so soziale Teilhabe und Lebensfreude.
Wie ist die Idee zu Zenaris entstanden und welches Problem wollten Sie damit ursprünglich lösen?
Unser Co-Founder Haken hatte während der Corona-Zeit erlebt, wie stark seine Schwieger-Oma unter sozialer Isolation und Einsamkeit litt – was letztlich auch zu kognitiven Einbußen geführt hat. Dieses Problem wollte er lösen. Erste Versuche mit bestehenden Technologien funktionierten nicht wie gewünscht. Als sich Hakan und Tim an der TU Darmstadt in einem Seminar kennenlernten, beschlossen sie, das Problem gemeinsam anzugehen. Daraus entstand schließlich Zenaris.
Was hat Sie motiviert, aus der Forschung heraus ein Unternehmen zu gründen, das sich auf digitale Teilhabe spezialisiert?
Wir haben beide Entrepreneurship und Innovation Management an der TU Darmstadt studiert. Das Thema digitale Teilhabe für ältere Menschen war für uns sehr greifbar, weil viele aus unserem Umfeld ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Das Seminar an der Universität gab uns die Möglichkeit, eine echte Lösung zu entwickeln – und wir hatten Freude daran, das Thema aus der Theorie in die Praxis zu bringen.
Wie funktioniert das System von Zenaris genau und wie wird der Fernseher dabei zum Tor in die digitale Welt?
Unser System basiert auf einer sehr einfach zu bedienenden Fernbedienung mit zwölf physischen Bildtasten. Jede Taste hat ein eigenes kleines Display, auf dem die jeweilige Funktion angezeigt wird. Das Prinzip ist: Ein Knopfdruck – eine Aktion am Fernseher. So können Nutzer nicht nur klassische Fernsehsender aufrufen, sondern auch Videotelefonate führen, On-Demand-Inhalte nutzen oder mit der ambulanten Pflege interagieren.
Für welche Menschen ist Ihre Lösung besonders gedacht und welche Rückmeldungen bekommen Sie aus der Zielgruppe?
Unser Fokus liegt auf pflegebedürftigen Menschen, insbesondere in der ambulanten Pflege. In aktuellen Pilotprojekten testen wir Zenaris in unterschiedlichen Umgebungen. Das Feedback ist sehr positiv – sowohl von den Nutzerinnen und Nutzern, die die einfache Bedienung schätzen, als auch von Pflegefachkräften, die eine Entlastung in ihrer täglichen Arbeit erleben.
Warum ist gerade der Fernseher als vertrautes Medium so entscheidend für den Erfolg Ihrer Technologie?
Der Fernseher ist das größte und vertrauteste Display im Haushalt – und nahezu alle Menschen in der ambulanten Pflege besitzen einen. Er ist ein vertrauter Bestandteil des Alltags und dadurch der ideale Zugangspunkt in die digitale Welt.
Welche Herausforderungen treten auf, wenn man Technologie speziell für ältere Menschen entwickelt, und wie gehen Sie damit um?
Am Anfang haben wir einige Annahmen getroffen und erste Prototypen gebaut, zum Beispiel mit Touchscreens – die wurden aber nicht gut angenommen. Wir haben schnell gelernt, dass wir eng mit der Zielgruppe zusammenarbeiten müssen. Seitdem testen wir jede Entwicklung gemeinsam mit den Nutzerinnen und Nutzern und beziehen ihr Feedback kontinuierlich ein.
Was unterscheidet Zenaris von anderen Ansätzen, die digitale Kommunikation für Senioren vereinfachen wollen?
Wir verzichten komplett auf Menüstrukturen und Touchscreens. Unser System läuft über den Fernseher, den die Zielgruppe bereits kennt. Zudem arbeiten wir eng mit Pflegeeinrichtungen zusammen – unser Ziel ist nicht nur Unterhaltung, sondern auch echte Unterstützung für Pflegekräfte. Wir sind die einzigen, die bisher von ambulanten Pflegediensten empfohlen werden, da unser System auch die Arbeit für Pflegekräfte vereinfacht.
Wie wichtig ist für Sie die Verbindung von Hardware, Software und einfacher Bedienbarkeit im Gesamtkonzept?
Diese Verbindung ist das Herzstück von Zenaris. Unser Anspruch ist, dass die Technologie funktioniert, ohne zu überfordern. Nur wenn Hardware, Software und Nutzererlebnis perfekt zusammenspielen, entsteht echte Akzeptanz.
Welche Rolle spielen Angehörige und Pflegekräfte in Ihrem System und wie unterstützen Sie diese Zielgruppe?
Neben der Fernsehlösung gibt es die Zenaris Family App. Angehörige oder Pflegekräfte können darüber die Funktionen der Fernbedienung individuell anpassen – zum Beispiel Fotoalben hochladen oder Videocalls starten, egal wo sie gerade sind. So werden sie aktiv in die Kommunikation und Verwaltung eingebunden.
Wo sehen Sie die größten Chancen für Zenaris in den nächsten Jahren und welche Weiterentwicklungen planen Sie?
Der Bedarf wächst stark: Immer mehr Menschen sind pflegebedürftig, während die verfügbaren Ressourcen und Fachkräfte abnehmen. Wir sehen großes Potenzial darin, die Pflege digital zu unterstützen und gleichzeitig Lebensqualität zu schaffen. Hier wollen wir weiter wachsen und unser System stetig verbessern.
Wie möchten Sie Ihr Produkt langfristig am Markt etablieren und gleichzeitig sozial wirksam bleiben?
Für uns gehören wirtschaftlicher Erfolg und sozialer Mehrwert zusammen. Wir wollen Lebensfreude und digitale Teilhabe ermöglichen – und gleichzeitig Pflegekräfte entlasten. Je besser uns das gelingt, desto größer ist auch der gesellschaftliche Nutzen. Wir messen aktiv unseren Impact & entwickeln Features gezielt mit dem Hintergrund die soziale Isolation von Pflegebedürftigen zu bekämpfen.
Welche drei Ratschläge würden Sie Gründerinnen und Gründern geben, die mit einer sozialen Innovation starten möchten?
Erstens: Eng mit der Zielgruppe zusammenarbeiten – testen, zuhören, verstehen.
Zweitens: Dranbleiben, auch wenn es mal länger dauert oder Rückschläge gibt.
Und drittens: Freude an der Arbeit mit Menschen behalten. Soziale Innovation lebt von echten Beziehungen.
Bild Tim Jefferys und Hakan Evcek @ Zensaris
Wir bedanken uns bei Tim Jefferys für das Interview
Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder