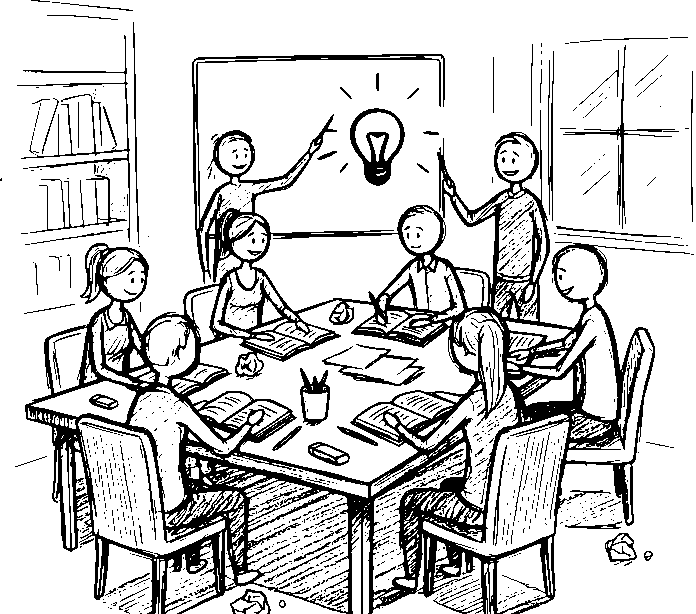Qred ist eine digitale Bank, die kleinen und mittleren Unternehmen schnellen und unkomplizierten Zugang zu Finanzierungen ermöglicht
Wie entstand die Idee zu Qred und wer sind die Köpfe hinter dem Unternehmen?
Die Idee zu Qred entstand nicht an einem langen Tisch gelangweilter Vorstandsmitglieder, sondern wurde aus purer Frustration über die fundamentale Ungerechtigkeit des Systems geboren. Wir Mitgründer sind selbst Mehrfachgründer. Wir haben die schwerfällige Bürokratie traditioneller Banken am eigenen Leib erfahren: seitenlange Formulare, Termine irgendwann in ferner Zukunft und sogar direkte Ablehnungen – selbst dann, wenn wir nur unser eigenes Kapital einzahlen wollten.
Der Moment der Erkenntnis kam, als mein Mitgründer und CEO Emil Sunvisson realisierte: Die Branche hat ein massives Problem. Traditionelle Banken schenken ausgerechnet den Kleinunternehmen die geringste Aufmerksamkeit und bieten ihnen den schlechtesten Service – und das, obwohl sie 80% der neuen Arbeitsplätze in unserer Gesellschaft schaffen.
Wir haben Qred 2015 auf Basis einer klaren Überzeugung gegründet: Unternehmer verdienen einen Finanzpartner, der genauso schnell ist wie sie selbst – und nicht einen, der im Tempo eines Faxgeräts arbeitet. Die Menschen hinter dem Unternehmen sind heute eine leidenschaftliche Mischung aus erfahrenen Bankexperten und Tech-Innovatoren. Uns alle eint eine zentrale mutige Mission: die Unternehmer*innen Europas zu stärken.
Wie lautet die Vision von Qred, wenn es um den Zugang zu Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen geht?
Unsere Vision ist einfach: Wir wollen die führende Bank für kleine und mittlere Unternehmen in Europa sein. Eine, die Unternehmer wirklich lieben.
Für traditionelle Banken sind Kleinunternehmen oft nur eine Randnotiz – ein Punkt, der schnell abgehakt wird. Wir sehen in ihnen das wirtschaftliche Rückgrat unserer Volkswirtschaft. Wir verlassen uns auf sie jeden Tag: Sie schneiden uns die Haare, fahren uns zum Flughafen, begrüßen uns in ihren Hotels und bauen unsere Häuser. Unsere Vision ist es, sicherzustellen, dass jeder Unternehmer einen fairen, transparenten und direkten Zugang zu den Finanzmitteln erhält, die er braucht, um zu investieren, zu wachsen und zu expandieren. Wir wollen nicht bloß eine Alternative sein; wir wollen die selbstverständliche erste Wahl sein – weil uns ihr Erfolg wirklich am Herzen liegt.
Was war die größte Hürde auf dem Weg von der Gründung bis zur heutigen Banklizenz und wie hat Qred sie überwunden?
Die größte Hürde war tatsächlich keine technologische; es war der kulturelle und regulatorische Spagat zwischen der Dynamik eines Start-ups und der erforderlichen Sorgfalt eines regulierten Finanzinstituts.
Fintechs sind schnell und innovativ, Banken etabliert und genießen Vertrauen. Um diese Kluft zu überbrücken, mussten wir beweisen, dass wir unser Innovationstempo aufrechterhalten und zeitgleich die höchsten Standards einer vollwertigen Bank erfüllen können. Das ist uns gelungen, indem wir unseren Kunden gegenüber sehr transparent und klar aufgetreten sind und gleichzeitig die Themen Regulatorik und Compliance extrem ernst genommen haben.
Wir können beweisen, dass unsere eigenentwickelten, KI-gestützten Systeme nicht nur schnell, sondern auch deutlich gründlicher und verantwortungsbewusster arbeiten als ein Kreditsachbearbeiter, der sich auf veraltete, langsame Prozesse stützt. Das Ergebnis war der Erhalt unserer Banklizenz. Sie ist ein eindrucksvolles Gütesiegel für unser Modell und erlaubt es uns, bessere Konditionen und Services anzubieten – etwas, wovor sich die alten Banken seit Jahrzehnten drücken. Gleichzeitig gilt: Wir sind jederzeit erreichbar und nur einen Anruf entfernt. Wir bieten den menschlichen Kontakt, wenn er zählt – das spiegelt sich ganz klar in unserer 4,8-Sterne Bewertung wider.
Wie gelingt es Qred, Kredite so schnell und unkompliziert zu vergeben, während traditionelle Banken oft Wochen brauchen?
Auf traditionellen Banken lasten überholte, komplizierte Altsysteme, die oft separate Insellösungen für verschiedene Bestandteile eines einzigen Produkts benötigen – zusätzlich zu den manuellen, papierbasierten Prozessen. Wir bei Qred haben unsere firmeneigene Kreditplattform von Grund auf neu entwickelt, angetrieben durch Machine Learning und KI.
Stellt ein Unternehmen einen Antrag, analysiert unser System sofort eine Vielzahl relevanter Datenquellen – weit mehr als nur den reinen Bonitäts-Score. So erhalten wir ein ganzheitliches Echtzeitbild der finanziellen Lage des Unternehmens. Wir ersetzen wochenlange, subjektive Entscheidungen von Menschen durch sekundenschnelle, datengesteuerte und objektive Analysen. Keine leeren Worte, sondern eine klare Finanzierung, die sich nach Ihnen richtet.
An welche Zielgruppe richtet sich Qred in Deutschland und welche besonderen Bedürfnisse weist dieser Markt im Vergleich zu anderen auf?
Unsere Zielgruppe – wie in all unseren Märkten – sind die Unternehmer, die oft durch das Raster der traditionellen Banken fallen. Das sind die Handwerker, die lokalen Einzelhändler, die Dienstleister – der wahre Mittelstand, der die Wirtschaft antreibt.
Gerade in Deutschland ist der Bedarf an Qred akut spürbar aufgrund der starken Fokussierung auf das traditionelle, filialbasierte Bankwesen und einer bisherigen Abneigung gegenüber digitaler Transformation im Bereich der Unternehmensfinanzierung. Deutsche KMU (Kleine und mittlere Unternehmen) werden von traditionellen Banken oft sogar noch stärker vernachlässigt als in anderen Märkten, da sie allein wegen der benötigten Kreditsumme in langatmige bürokratische Prozesse gezwungen werden. Die Bedürfnisse deutscher Unternehmer sind somit verstärkt: Sie benötigen einen Partner, der Geschwindigkeit, Transparenz und einen Service mit hohem Vertrauensfaktor bietet, ohne dabei die Gründlichkeit zu vernachlässigen, die für die deutsche Unternehmenskultur unerlässlich ist. ‘Mega schnell’ ist eines der häufigsten Kundenfeedbacks, die wir erhalten!
Wodurch hebt sich das Geschäftsmodell von Qred von traditionellen Banken und anderen Fintech-Wettbewerbern ab?
Unsere Einzigartigkeit ergibt sich aus unserer wettbewerbsfähigen Positionierung als Technologieunternehmen mit Banklizenz, das sich ausschließlich auf KMU (Kleine und mittlere Unternehmen) fokussiert.
Im Vergleich zu traditionellen Banken: Sie sind langsam, priorisieren Großkunden und nutzen veraltete Technologien. Unser Ansatz ist von Grund auf digital, mit einem kompromisslosen Fokus auf das KMU-Segment. Unsere firmeneigene KI-Technologie sorgt dabei für maximale Geschwindigkeit.
Im Vergleich zu reinen Fintech-Wettbewerbern: Blickt man bei vielen Fintechs hinter die juristische Fassade, entpuppen sie sich oft als reine Kontaktvermittler oder unregulierte Kreditgeber. Teilweise greifen sie dabei auf zweifelhafte Finanzkonstruktionen mit Sitz in Steuerparadiesen zurück – wahrscheinlich, um sich der Regulierung zu entziehen.
Wir hingegen sind eine vollwertige, regulierte Bank und stehen somit unter der Aufsicht der schwedischen Finanzbehörde. Für uns bedeutet das, dass wir wettbewerbsfähige Finanzierungen anbieten, Produkte wie Sparkonten oder Bezahllösungen einführen und eine tiefgehende, langfristige Beziehung zu unseren Kunden aufbauen können. In unseren Augen sollte uns die Rolle als seriöser und engagierter Akteur im deutschen KMU-Finanzierungs- und Bankengeschäft eine nachhaltige Position gegenüber unseren strategischen Partnern und Kunden ermöglichen.
Wie stellt Qred sicher, dass die Kreditvergabe trotz digitaler Prozesse verantwortungsvoll und fair bleibt?
Tatsächlich machen unsere digitalen Prozesse die Kreditvergabe sogar noch verantwortungsvoller und fairer. Ihr Zweck ist es nicht, an der falschen Stelle zu sparen, sondern den Zeitaufwand zu reduzieren und Subjektivität zu eliminieren.
Unser selbst entwickeltes Scoring-System beruht auf einer umfangreichen Datengrundlage aus über zehn Jahren Marktpräsenz mit hochentwickelten Risikomodellen. Dies ermöglicht uns eine tiefgehendere und fundiertere Bonitätsprüfung, als es einer Bank, die sich oft nur auf veraltete Daten stützt, möglich ist. Unser Preismodell mit fester Monatsgebühr sorgt für volle Kostentransparenz – ganz ohne Kleingedrucktes oder versteckte Zusatzkosten. Zudem ist unser hervorragendes und engagiertes deutsches Kundenservice-Team bei Fragen immer schnell erreichbar, sei es per Telefon, Chat oder E-Mail.
Welche technologischen Innovationen spielen bei Qred eine zentrale Rolle, um den Finanzierungsprozess effizienter zu gestalten?
Im Zentrum unserer Innovation steht unsere firmeneigene, auf maschinellem Lernen und KI basierende Plattform. Das sind für uns keine bloßen Marketing-Schlagwörter; es ist der Motor unseres Geschäfts und etwas, das wir bereits entwickelt haben, lange bevor KI in aller Munde war. Unsere Plattform ermöglicht es uns, Anträge schnell zu bearbeiten und ein fundiertes sowie faires Angebot zu unterbreiten. Sobald dieses angenommen wird, erfolgt die Auszahlung des Geldes unverzüglich.
Was ist Qreds langfristige Wachstumsstrategie in Deutschland und Europa?
Unsere Strategie ist es, mehr Unternehmer in ganz Europa zu stärken. Wir haben bewiesen, dass unser Modell wirklich skaliert und in vielen Märkten funktioniert, da wir bereits in den nordischen Ländern und den Benelux-Staaten tätig sind. Es erfüllt uns mit Stolz und Bescheidenheit, die einzige Bank zu sein, die in all diesen Regionen KMU-Finanzierungen anbietet. Diese Position verschafft uns einen strategischen Vorteil beim Aufbau dynamischer Partnerschaften und beim Einblick in Branchen, die über nationale Grenzen hinaus agieren.
In Deutschland konzentrieren wir uns darauf, schnell zu wachsen und mehr Unternehmen durch ein ausgezeichnetes Bankerlebnis zu helfen. Außerdem planen wir unser Angebot Anfang nächsten Jahres mit der Qred VISA zu erweitern – einer Business-Kreditkarte, die speziell auf Kleinunternehmen zugeschnitten ist. Seid gespannt!
Was motiviert das Team hinter Qred, jeden Tag an Finanzierungslösungen für KMU zu arbeiten?
Wir sprechen jeden Tag mit unseren Kunden. Es ist ein wirklich großes Privileg, so vielen von ihnen bei ihren ganz realen Problemen helfen zu dürfen. Für die meisten Unternehmer gehen Geschäftliches und Privates Hand in Hand; das lässt sich nicht einfach trennen. Wenn wir in kritischen Situationen einspringen und aushelfen können oder das Kapital bereitstellen, das sie für ihre Expansion und die Erfüllung ihres Traums benötigen, gibt uns das all die Motivation, die wir brauchen. Jeder Kredit, den wir genehmigen, jedes neue Produkt, das wir einführen, trägt direkt dazu bei, dass ein Kleinunternehmen eine neue Person einstellt, in neue Ausrüstung investiert oder in einen neuen Markt expandiert. Tatsächlich zeigen unsere Daten, dass Qred-Kunden mit unserer Finanzierung jedes Jahr Tausende von Arbeitsplätzen schaffen.
Und schließlich: Aufgrund unserer eigenen Erfahrung und Werdegangs kennen wir die Herausforderungen, denn wir selbst sind Unternehmer. Dieser tiefe, leidenschaftliche Glaube an den Kleinunternehmer ist es, der uns jeden Morgen aus dem Bett treibt, um eine Bank aufzubauen, die wirklich auf ihrer Seite steht.
Welche drei Ratschläge würden Sie anderen Gründern geben, die ein skalierbares und nachhaltiges Fintech-Unternehmen auf die Beine stellen wollen?
Mein guter Freund und CEO, Emil Sunvisson, würde wahrscheinlich folgenden Rat geben:
Die oberste Regel: Bleibt nah am Kunden und stellt ihn konsequent in den Mittelpunkt. Entwickelt keine App als reines Gimmick, dem der Zweck noch fehlt. Findet stattdessen ein gravierendes, reales Problem, das die etablierten Spieler auf dem Markt ignorieren – etwa Banken, die KMU abweisen, obwohl diese Arbeitsplätze schaffen. Und genau das löst ihr. Wer dieses Problem nicht besser und schneller löst als alle anderen, ist schlichtweg bedeutungslos – nur ein weiteres digitales Störgeräusch.
Profitabilität ist keine Option, sondern ein Muss.
Vergesst das übermäßig genutzte Mantra „Wachstum um jeden Preis“. Baut ein echtes Unternehmen, das von Anfang an profitabel arbeitet. Profitabilität ist nicht nur ein Zeichen für ein funktionierendes Geschäftsmodell; sie ist das Einzige, was eure Unabhängigkeit sichert und euren Kunden ultimative Stabilität und Vertrauen gibt. Fintechs, die massive Verluste machen, könnten morgen schon wieder vom Markt sein. Qred wurde für eine nachhaltige Zukunft gebaut. Unsere Verantwortung gilt unseren Kunden, statt uns nur von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde zu hangeln.
Macht keine halben Sachen; baut es von Anfang an richtig auf. Natürlich muss man Prioritäten setzen und Kompromisse eingehen, aber das ist nicht dasselbe. Wer eine festgefahrene Branche aufmischen will, muss es besser machen als der Rest. Für uns bedeutete das: eine volle Banklizenz. Das garantiert, dass wir alle Vorschriften befolgen, unser Geschäft voll im Griff haben und unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit sowie ein erstklassiges Angebot bieten können. Definiert den Goldstandard in eurer Branche – das ist der entscheidende Schritt, der euch gegenüber euren Kunden als ernsthaften, langfristigen Partner auszeichnet.
Bild Moritz Wendt (l.), Country Manager Germany, und Jason Francis, Co-Founder von Qred. Bildrechte Qred
Wir bedanken uns bei Moritz Wendt und Jason Francis für das Interview
Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder