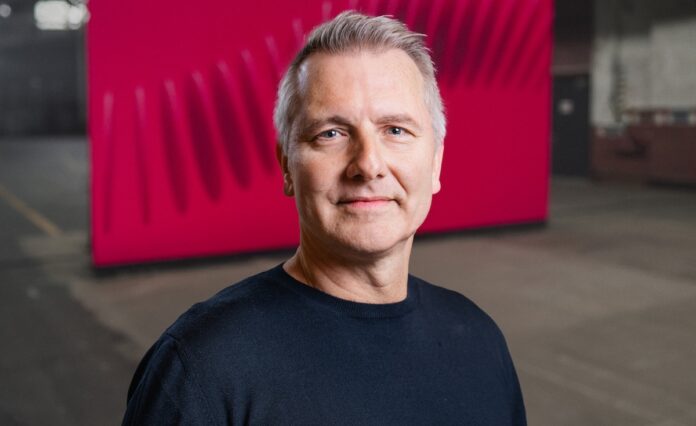doitactive ist eine Plattform, die Menschen über gemeinsame Aktivitäten zusammenbringt und echte Begegnungen statt endlosem Scrollen ermöglicht
Was war der ursprüngliche Antrieb, doitactive zu gründen, und wie hat sich die Idee zu einer Plattform für aktive Freizeitgestaltung entwickelt?
Ich hatte schon lange den Wunsch, etwas zu schaffen, das Menschen wieder im echten Leben zusammenbringt. Mir ist aufgefallen, dass viele ihre Freizeit passiv verbringen – online, aber nicht miteinander. Aus dieser Beobachtung entstand die Idee, eine Plattform zu entwickeln, auf der Freizeit wieder aktiv gestaltet wird. Also nicht nur scrollen, sondern wirklich erleben.
Die Idee zu doitactive hatte ich bereits 2013. NRW ist mittlerweile mein fünftes Bundesland, inklusive eines zweijährigen Auslandsaufenthalts. Ich habe über viele Jahre erlebt, wie schwierig es wird, nach jedem Umzug ein neues soziales Umfeld aufzubauen. Oft blieb nur die Arbeit als „Zufluchtsort“, um nicht inaktiv zu werden. Auch auf Geschäftsreisen habe ich gemerkt, wie wenig Möglichkeiten es gibt, spontan neue Menschen kennenzulernen oder passende Aktivitäten zu finden.
Ein weiterer Auslöser war meine zunehmende Dissonanz gegenüber den großen Social-Media-Kanälen – zu viel Konsum, zu wenig echte Begegnung. Nach einem Jobverlust habe ich die Entscheidung getroffen, diese Idee endlich umzusetzen. Es ist nicht einfach, sich gegen die großen Plattformen durchzusetzen, aber ich glaube, dass jetzt die richtige Zeit ist, wieder unabhängiger zu werden und das Leben draußen zu genießen.
doitactive soll Menschen dazu inspirieren, wieder eigene Aktivitäten zu gestalten – vom Spielplatzfest über den Grillabend bis zum gemeinsamen Theaterbesuch. Und gleichzeitig den regionalen Markt stärken, indem Vereine, Betriebe und Veranstalter eine faire Bühne bekommen.
Welche Personen stehen hinter doitactive und welche Erfahrungen oder Leidenschaften haben sie in das Projekt eingebracht?
Hinter doitactive steht ein kleines, aber engagiertes Team aus erfahrenen Partnern. Triboot Technologies begleitet die technische Entwicklung der App, SEO-Retter unterstützt bei Website und Sichtbarkeit, und über Blogger und ausgewählte Social-Media-Partner bringen wir unsere Themen emotional nach außen. Social Media soll langfristig nur noch ergänzend eingesetzt werden – aktuell müssen wir dort jedoch präsent sein, um die Menschen zu erreichen.
Ich selbst komme aus dem Bereich Logistik und Strategie und verbinde diese Erfahrung mit dem Wunsch, etwas Sinnvolles für die Gesellschaft zu schaffen.
Wie beschreibt ihr die Vision von doitactive – was möchtet ihr langfristig in der Gesellschaft oder im Freizeitverhalten verändern?
Unsere Vision ist es, Menschen wieder regional zu vernetzen – auf einfache, positive und sichere Weise. Wir möchten, dass Freizeit nicht nur konsumiert, sondern geteilt wird. Dass Menschen entdecken, was in ihrer Umgebung passiert, und dadurch neue Kontakte, Freundschaften oder sogar Projekte entstehen. Langfristig wollen wir dazu beitragen, dass Freizeit wieder zu echter Lebensqualität führt – unabhängig vom Alter oder Lebensstil.
Unser Ziel ist es, die App Nummer 1 für die Organisation von Aktivitäten und echten Begegnungen zu werden – frei von Algorithmen und Abhängigkeiten großer Social-Media-Konzerne. Freizeit soll wieder Leben und Sinn stiften, nicht Ablenkung.
Eure Plattform vernetzt Menschen über gemeinsame Aktivitäten. Welche Zielgruppen sprecht ihr dabei besonders an und wie schafft ihr es, deren Bedürfnisse gezielt zu erfüllen?
Wir sprechen alle an, die mehr erleben wollen – egal ob jung oder älter. Besonders stark sind wir bei Menschen ab 30, die gezielt nach Freizeitaktivitäten suchen, und bei der Generation 60+, die wieder aktiver am gesellschaftlichen Leben teilnehmen möchte. Gleichzeitig sehen wir großes Potenzial in der Altersgruppe 18 bis 29 – hier wollen wir bewusst den gesellschaftlichen Mehrwert betonen.
Wir kombinieren dabei einfache Technik mit echtem Nutzen: Übersichtliche Suche, lokale Vorschläge, Chat-Funktionen und faire Konditionen für Anbieter und Veranstalter. Jeder kann selbst Aktivitäten einstellen oder Suchanfragen starten – vom Spielplatzfest über den Kochkurs bis zum Lauftreff im Park.
Viele Menschen suchen heute nach echten Begegnungen statt Social Media Scrollen. Wie trägt doitactive konkret dazu bei, diese Lücke zu schließen?
doitactive bringt Menschen über gemeinsame Interessen zusammen – nicht über Algorithmen. Bei uns steht das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt. Ob Kochkurs, Grillabend, Theaterbesuch oder Spaziergang – wer etwas sucht, findet passende Aktivitäten in seiner Nähe. Wer selbst etwas anbietet, erreicht mit wenigen Klicks genau die Menschen, die wirklich interessiert sind. So entstehen reale Begegnungen statt digitaler Ablenkung.
Unser Leben ist schon komplex und unübersichtlich genug – muss es aber nicht sein. Oft wird uns Komplexität verkauft. Wir setzen bewusst auf Einfachheit und Klarheit. Freizeit soll wieder Freude machen, nicht überfordern.
doitactive.de ist die App für alle Aktivitäten – einfach, menschlich und ohne Störung oder Unterbrechung.
Was unterscheidet eure Plattform von anderen Freizeit- oder Event-Apps? Wo seht ihr euren besonderen Mehrwert für Nutzer und Veranstalter?
Unser Ansatz ist fair, regional und transparent. Wir verzichten bewusst auf versteckte Gebühren, starre Premium-Modelle oder aggressive Werbung. Nutzer können sich frei vernetzen und kommunizieren. Veranstalter und Vereine bekommen eine faire Bühne, um sichtbar zu werden – ohne Provisionsdruck oder große Budgets.
Der besondere Mehrwert liegt in der Einfachheit: Jede und jeder kann selbst aktiv werden, neue Menschen kennenlernen oder Aktivitäten organisieren – ganz ohne technische Hürden.
Wie gewinnt ihr neue Nutzerinnen und Nutzer – und welche Rolle spielt dabei die lokale Community?
Ein Großteil unseres Wachstums entsteht durch authentische Empfehlungen. Wir arbeiten mit regionalen Medien, Bloggern und Vereinen zusammen, um unsere App in die Communities zu bringen. Die lokale Vernetzung ist der Schlüssel: Menschen entdecken Aktivitäten in ihrer Umgebung und erzählen anderen davon. Dadurch wächst doitactive organisch und bleibt nah an den Menschen, für die wir es entwickelt haben.
Welche Herausforderungen begegnen euch aktuell bei der Weiterentwicklung von doitactive, und wie geht ihr als Team damit um?
Als Startup müssen wir Prioritäten sehr klar setzen. Es gibt immer mehr Ideen als Zeit und Budget. Unsere größte Herausforderung ist, das Nutzerwachstum mit der technischen Weiterentwicklung in Einklang zu bringen. Wir arbeiten dabei sehr agil mit unseren Partnern zusammen – kurze Wege, ehrliches Feedback und klare Entscheidungen. Das hilft, auch mit begrenzten Ressourcen gute Ergebnisse zu erzielen.
Aktuell liegt der Fokus darauf, noch mehr Menschen zu erreichen und Vereine sowie Betriebe von der Idee hinter doitactive zu begeistern – also zu zeigen, dass die Plattform kein „Spielplatz“, sondern ein echter Begegnungsort für Aktivitäten ist. Das braucht Zeit, Vertrauen und natürlich auch Sichtbarkeit.
Wir sehen diese Phase aber als Chance, die Plattform gemeinsam mit unseren Partnern und der Community weiterzuentwickeln. Wer sich aktiv einbringen oder Kooperationen anstoßen möchte, ist herzlich willkommen, Teil dieser Bewegung zu werden.
Plant ihr, das Angebot künftig um neue Funktionen oder Partnerschaften zu erweitern, um noch mehr Menschen zu erreichen?
Ja, absolut. Wir arbeiten derzeit an einer stärkeren regionalen Ausspielung von Inhalten und an Kooperationen mit Partnern aus dem Freizeit- und Vereinsbereich. Außerdem wollen wir unsere Chat- und Gruppenfunktionen erweitern, damit Nutzer Aktivitäten noch besser planen können.
Langfristig sind auch thematische Kooperationen mit Städten, Veranstaltern oder touristischen Regionen geplant. Ziel ist, dass doitactive zum digitalen Treffpunkt für Freizeit und Gemeinschaft wird.
Wie wichtig ist euch das Thema Nachhaltigkeit oder sozialer Mehrwert in der Entwicklung eurer Plattform?
Sehr wichtig. Nachhaltigkeit bedeutet für uns nicht nur Umwelt, sondern auch soziale Verantwortung. Wenn Menschen durch doitactive neue Kontakte knüpfen, lokale Anbieter unterstützen und Vereinsleben fördern, entsteht automatisch ein gesellschaftlicher Mehrwert. Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dass Freizeit nicht nur individuell, sondern gemeinschaftlich erlebt wird.
Darüber hinaus legen wir großen Wert auf Sicherheit und respektvollen Umgang. Unter dem Bereich „Chat & Sicherheit“ in der App finden Nutzer klare Hinweise, wie sie sicher mit anderen kommunizieren und Aktivitäten organisieren können – offen, aber achtsam. Auch das verstehen wir als Teil einer nachhaltigen, verantwortungsvollen Plattformkultur.
Was motiviert euch persönlich, doitactive jeden Tag weiter voranzubringen?
Mich motivieren die Geschichten, die durch die Plattform entstehen. Wenn Menschen neue Freunde finden, Aktivitäten ausprobieren oder durch uns auf Veranstaltungen aufmerksam werden, zeigt das: Die Idee funktioniert. Jede Rückmeldung, jeder neue Nutzer ist ein Stück Bestätigung. Das motiviert uns, die Plattform immer weiter zu verbessern.
Welche drei Ratschläge würdet ihr anderen Gründerinnen und Gründern mitgeben, die ebenfalls eine Plattform oder Community aufbauen möchten?
Erstens: Starte mit einer klaren Vision, aber bleib flexibel.
Zweitens: Umgib dich mit Menschen, die dich ergänzen, nicht kopieren.
Drittens: Denk langfristig – eine Community entsteht nicht über Nacht, sondern durch Vertrauen, Ausdauer und echte Begeisterung.
Foto: Eventfotograf Mud Masters Laufs bearbeitet von doitacitve
Wir bedanken uns bei Christos Kosmas für das Interview
Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder
Premium Start-up: doitactive

Kontakt:
doitactive.de
Christos Kosmas
Margarete-Rudoll-Weg 11
D-45239 Essen
https://doitactive.de/
info@doitactive.de
Ansprechpartner: Christos Kosmas