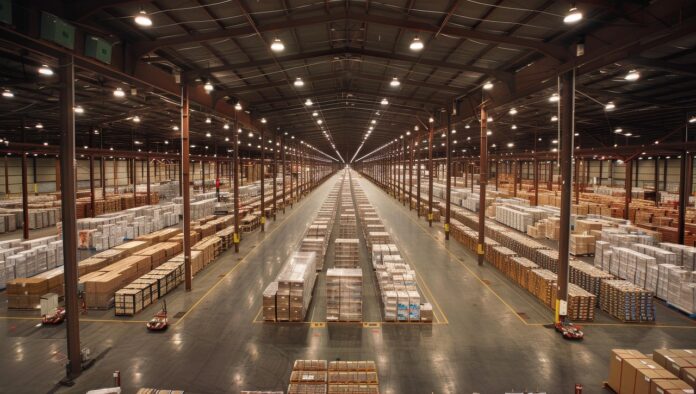MARO.COFFEE entwickelt smarte Siebträgermaschinen, die moderne Technologie mit echtem Kaffeegenuss verbinden und das Espressoerlebnis für Zuhause und Büro neu definieren
Wie ist MARO.COFFEE entstanden und was war der Moment, in dem die Idee zur smarten Siebträgermaschine geboren wurde?
MARO ist aus einem sehr einfachen Bedürfnis entstanden: morgens schnell einen richtig guten Espresso zu machen – ohne lange Wartezeiten, ohne Kompromisse und ohne unnötig kompliziertes Handling. In der Praxis gab es damals nur zwei Extreme: günstige Maschinen, die inkonsistent waren, oder teure High-End-Systeme, die zwar beeindruckend aussahen, im Inneren aber auch auf jahrzehntealter Technik basierten.
Zur Zeit, als die Idee entstand, war der Stand der Espressotechnik im Grunde noch derselbe wie vor über 60 Jahren. Lange Aufheizzeiten, hoher Energieverbrauch und eine Genauigkeit, die nicht zu den Ansprüchen moderner Specialty-Kundinnen und -Kunden passte. Wir konnten einfach nicht verstehen, warum niemand die Siebträgermaschine einmal komplett neu denkt – mit den technischen Möglichkeiten, die es heute gibt.
Die Grundidee war also: eine Maschine zu bauen, die nicht nur Kaffee zubereitet, sondern versteht, was sie tut. Die komplexe Prozesse automatisch richtig macht, den Nutzer unterstützt und verlässliche Ergebnisse liefert – und das Ganze in einem Gerät, das Spaß macht, statt Frust zu erzeugen. Das war der Moment, in dem MARO geboren wurde.
Was treibt euch als Gründerteam an – und wie hat sich euer Weg von Kindergeld und Nebenjobs hin zu einer High-End-Kaffeemaschine entwickelt?
Uns treibt vor allem die Neugier an, Dinge besser zu machen, als sie heute sind – und die Lust, Technologie sinnvoll einzusetzen. Wir sind keine klassischen BWL-Gründer, sondern Technik- und Kaffeeliebhaber, die irgendwann gemerkt haben, dass sie gemeinsam etwas bauen können, das es so noch nicht gibt.
Am Anfang war das alles ziemlich improvisiert. Robin hat studiert, ich habe ein Bundesfreiwilligendienst und einen Nebenjob als Barista gehabt um die paar Bauteile und Werkzeuge zu kaufen, die wir am Anfang wirklich gebraucht haben. Wir haben viel gelernt, gebastelt, Fehler gemacht und und neu gedacht. Aber genau das hat uns geholfen, wirklich zu verstehen, wie man eine Maschine entwickelt, die nicht nur technisch spannend ist, sondern auch im Alltag funktioniert.
Heute stehen wir da mit einer High-End-Maschine, die komplett in Deutschland gebaut wird und technisch auf einem Level ist, das vor ein paar Jahren für uns selbst noch utopisch klang. Der Weg dahin war kein Businessplan, sondern ein permanentes „Warum eigentlich nicht?“, “Was wäre denn nach diesem Schritt der Nächste”– und die Überzeugung, dass guter Kaffee und moderne Technik kein Widerspruch sein müssen.
Wie würdet ihr die Vision von MARO.COFFEE in einem Satz beschreiben und was bedeutet sie für die Zukunft des Kaffeegenusses im Büro?
Unsere Vision ist es, den Kaffeegenuss neu zu denken – mit Maschinen, die verstehen, was sie tun, sich an die Bedürfnisse des Anwenders/ der Anwenderin anpassen und dadurch überall verlässliche Ergebnisse liefern, egal ob zuhause oder im Büro. Für uns heißt das: weniger Kompromisse, so viel Komplexität wie vom User gewünscht, mehr Freude am Kaffee. Unser Fokus liegt aktuell auf dem Heimmarkt, aber auch einige Büros oder Cafés haben wir mit Model 1 bereits zu neuem Espressogenuss und verlässlicher Koffeinversorgung verhelfen können.
Welche Zielgruppen habt ihr besonders im Blick – und wie verändert euer Ansatz das Kaffeeerlebnis in Agenturen, Coworking-Spaces oder Homeoffices?
Die Entwicklung von Model 1 orientiert sich stark an den Bedürfnissen von Home-Baristi – allerdings an der gesamten Bandbreite: vom Einsteiger, der einfach einen konstant guten Espresso will, bis zum Nerd, der jedes Detail seiner Extraktion verstehen möchte. Das war uns wichtig, weil guter Kaffee keine Frage des Könnens, sondern der Möglichkeiten sein sollte. Grandioserweise funktioniert dieser Ansatz auch für so ziemlich jeden anderen Anwendungsort – ob im Büro, im Coworking-Space oder im kleinen Café. Das Resultat ist immer dasselbe: mehr Bewusstsein für Kaffeequalität, mehr Spaß am Zubereiten und ein ganz neues Verhältnis zu Technik im Alltag. Statt Kompromisse zu machen, kann man sich endlich auf das konzentrieren, worum es eigentlich geht – richtig guten Kaffee.
Was unterscheidet die MARO Model 1 von klassischen Siebträgermaschinen und worin liegt ihr technologischer Vorsprung?
Die MARO Model 1 unterscheidet sich von klassischen Siebträgermaschinen vor allem darin, dass sie von Grund auf neu gedacht wurde – mit heutiger Technologie statt mit 60 Jahre alten Prinzipien. Während herkömmliche Maschinen oft 25 bis 30 Minuten zum Aufheizen brauchen, ist die Model 1 in rund drei Minuten bereit – spart dabei im Alltag eine riesige Menge Energie und funktioniert dazu noch zuverlässiger als die Konkurrenz mit riesigen Boilern. Möglich wird das durch ein hochpräzises, digital geregeltes System, das nur dann Wasser erhitzt, wenn es auch wirklich benötigt wird.
Ihr technologischer Vorsprung zeigt sich besonders im Alltag an Beispielen aus Funktionen von Model 1:
Der Smart Profiler greift während der Extraktion auf Wunsch aktiv ein, wenn der Mahlgrad nicht optimal passt oder bei der Vorbereitung ein Fehler passiert ist. Die Maschine regelt dann während des Bezugs automatisch gegen und sorgt dafür, dass der Shot trotzdem gelingt – statt im Ausguss zu landen. So wird nicht nur erklärt, was passiert, sondern direkt verhindert, dass Kaffee verschwendet wird. Unser Grind Analyzer ergänzt das, indem er dem User klar erklärt, was mit der Einstellung der separaten Mühle zu tun ist (häufig größte Schwierigkeit bei Einsteigern) indem er klar Empfehlungen für die Richtung (gröber oder feiner) und die Größe der Änderung empfiehlt. So muss nicht gegoogelt oder gerätselt werden, es geht einfach von der Hand.
Durch die verschiedenen Modi – vom Explorer- bis zum Extreme-Modus – wächst die Maschine mit ihren Nutzern mit. Einsteiger lernen schnell, tollen Espresso zu machen, und wer tiefer einsteigen will, findet keinerlei Grenzen mehr. Genau diese Spannweite macht die Model 1 so besonders: Sie ist einfach, wenn sie es sein soll, und grenzenlos präzise, wenn man es will.
Und das gilt weit über die Espressozubereitung hinaus. Unser nutzerzentriertes Denken und der hohe Digitalisierungsgrad ermöglichen unendlich viele Wow-Momente – durch intelligente Nutzerführung, durchdachtes Design und Workflows, die Spaß machen, statt zu überfordern. MARO steht für Technologie, die nicht das tolle Handwerk ersetzt, sondern befähigt – und so den Alltag mit jedem Kaffee ein Stück besser macht.
Wie wichtig ist euch die Verbindung aus Design, Nachhaltigkeit und Technik – und wie spiegelt sich dieser Anspruch in eurer Maschine wider?
Design, Nachhaltigkeit und Technik gehören bei uns untrennbar zusammen. Wir glauben nicht an schöne Maschinen, die technisch veraltet sind – und auch nicht an technische Innovation ohne Sinn für Gestaltung oder Verantwortung. Bei der MARO Model 1 beeinflusst jedes Detail das andere.
Das Design folgt immer einer Funktion: klare Linien, hochwertige Materialien, intuitive Bedienung. Gleichzeitig setzen wir auf nachhaltige Produktion – kurze Lieferketten, recycelbare Materialien, reparierbare Bauweise und Fertigung in Deutschland. Das sorgt nicht nur für Langlebigkeit, sondern auch für Transparenz darüber, woher jedes Bauteil kommt.
Technisch ist Nachhaltigkeit genauso relevant. Durch den extrem schnellen Aufheizvorgang und das boilerlose System, verbraucht Model 1 am Tag so viel Energie wie manche Boiler-Maschinen nur zum Aufheizen – ohne Einbußen bei der Präzision. Und weil die Maschine softwarebasiert arbeitet, kann sie über Updates ständig besser werden, statt irgendwann ersetzt zu werden.
Am Ende steht ein Gesamtsystem, das nicht zwischen Design, Technik und Nachhaltigkeit trennt, sondern sie zu einem Gedanken verbindet: Kaffeegenuss kann ästhetisch, effizient und verantwortungsvoll zugleich sein.
Community-Driven Development ist für uns tägliche Realität. Die meisten Ideen entstehen direkt aus dem Austausch mit unserer Community – also mit den Menschen, die die MARO Model 1 jeden Tag benutzen. Sie merken als Erste, wo im Workflow noch etwas besser werden kann oder welche Funktion den Alltag wirklich erleichtert.
Wir bekommen Feedback über unser Online-Forum, Supportkanäle und Social Media, aber auch durch sehr direkte Gespräche mit Nutzerinnen und Nutzern. Wenn jemand ein Problem beschreibt oder eine Idee teilt, landet das nicht in einer anonymen Liste, sondern direkt bei uns: im Entwicklerteam. Der Großteil der neuen Features oder Verbesserungen sind genau so entstanden.
Das Besondere ist, dass wir diese Rückmeldungen in einem digitalen System umsetzen können. Die Model 1 ist softwarebasiert und updatefähig, das heißt: Feedback kann innerhalb weniger Wochen zu einer realen Verbesserung werden. So wächst die Maschine gemeinsam mit ihrer Community – und genau das macht sie lebendig.
Welche Herausforderungen habt ihr bisher beim Aufbau eures Unternehmens erlebt und wie habt ihr sie gemeistert?
Wir haben mitten in der Corona-Zeit gegründet – also genau dann, als Lieferketten zusammengebrochen sind und Elektronikbauteile praktisch über Nacht zur Mangelware wurden. Für ein junges Hardware-Startup ohne große VC-Finanzierung war das ein echter Stresstest. Viele Bauteile waren schlicht nicht verfügbar, und wir mussten lernen, mit dem zu arbeiten, was wir kriegen konnten – ohne Abstriche bei Qualität oder Präzision zu machen.
Gleichzeitig hatten wir ambitionierte Entwicklungsziele, deren Umsetzbarkeit zu Beginn niemand garantieren konnte. Wir wollten Technologien einsetzen, die es so in keiner Espressomaschine gab, und mussten sie während der Entwicklung erst beweisen. Das hieß: unzählige Prototypen, Testzyklen und Rückschläge – bis alles so funktionierte, wie wir es uns vorgestellt hatten.
Ein weiteres großes Thema war das Liquiditätsmanagement. Hardware bedeutet hohe Vorfinanzierung, lange Entwicklungszyklen und viel gebundenes Kapital. Wenn man – wie wir – nicht mit Millionen an Risikokapital startet, muss jeder Euro sitzen. Wir haben früh gelernt, sehr diszipliniert zu planen, kreativ zu beschaffen und Risiken genau zu kalkulieren.
Und: Wir hatten keine bestehenden Netzwerke, keine Industrieerfahrung, keine Kontakte. Wir kamen direkt aus der Schule – buchstäblich von Null. Das hat uns gezwungen, alles selbst aufzubauen: Lieferketten, Partner, Prozesse. Heute sind genau diese Strukturen unsere größte Stärke.
Am Ende trifft der Satz „Hardware is hard“ den Punkt ziemlich genau. Aber es ist auch der Grund, warum wir so nah an unserem Produkt, unseren Kunden und jeder einzelnen Entscheidung geblieben sind. Jede Hürde hat uns gezwungen, besser zu werden – und genau das hat MARO geprägt.
Wie groß ist der Einfluss von Software und digitalen Features im Vergleich zu klassischem Maschinenbau – und wo seht ihr die Zukunft des Kaffeemarkts?
Software spielt bei uns eine mindestens ebenso große Rolle wie klassischer Maschinenbau. Wir sehen Hardware als stabile Basis – aber alles, was sie wirklich lebendig macht, entsteht durch Software, Datenerfassung und digitale Features.
Durch digitale Oberflächen, präzise Sensorik und regelmäßige Softwareupdates sind wir in der Lage, aus einem bestehenden Hardware-Set immer wieder die neueste Maschine zu machen – während sie längst beim Kunden steht. Das bedeutet: technische Weiterentwicklung, neue Funktionen und Verbesserungen kommen direkt zu den Nutzerinnen und Nutzern, ohne dass eine neue Maschine nötig ist.
Gleichzeitig erlaubt uns dieser Digitalisierungsgrad, notwendige Wartungen frühzeitig zu erkennen und auf dieser Basis künftig Services anzubieten, die weit über klassische Maschinenpflege hinausgehen.
Ein gutes Beispiel dafür ist MARO Home – unsere digitale Plattform, die das Maschinen-Ökosystem erweitert. Sie ermöglicht nicht nur neue Business-Modelle, sondern auch neue Touchpoints: Nutzer können Profile teilen, Daten verstehen, ihre Maschine personalisieren und erleben, wie sich Kaffeezubereitung Schritt für Schritt weiterentwickelt.
Für uns liegt die Zukunft des Kaffeemarkts genau hier: in der Verbindung aus präziser Hardware und intelligenter Software. Das Ergebnis ist nicht einfach eine bessere Maschine, sondern ein lernendes System – eines, das mit seinen Nutzerinnen und Nutzern wächst und den Kaffeegenuss neu definiert.
Welche Rolle spielt das Thema Fairness – von der Produktion bis zur Bohne – in eurer täglichen Arbeit?
Fairness bedeutet für uns, Verantwortung zu übernehmen – in der Produktion, im Umgang mit Partnern und im Bewusstsein, dass eine Siebträgermaschine immer auch ein Luxusgut ist. Die nachhaltigste Espressomaschine steht in einem Café und brüht hunderte Espressi am Tag. Uns ist bewusst, dass unsere Maschinen in der Regel nicht dort stehen – also versuchen wir, in unserem Rahmen einfach so viel wie möglich richtig zu machen: bei der Beschaffung, der Energieeffizienz, der Reparierbarkeit und der Langlebigkeit.
Die MARO Model 1 wird in Deutschland gefertigt, mit kurzen Lieferketten und Materialien, die langlebig und recycelbar sind. Wir kennen die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, und legen Wert auf faire Bedingungen – von der Konstruktion bis zur Montage.
Beim Thema Kaffee selbst ist uns wichtig zu betonen, dass die Qualität in der Tasse maßgeblich von der Qualität der Bohnen abhängt. Wirklich guter Kaffee entsteht nur dort, wo beim Anbau mit Aufmerksamkeit und Sorgfalt gearbeitet wird – das ist der Kern von Specialty Coffee. Auch wenn wir selbst keine Bohnen verkaufen, unterstützen wir das, was dahintersteht: Zu jeder Model 1 legen wir lokal geröstete und fair eingekaufte Bohnen bei, um den Genussmoment vom ersten Shot an zu fördern und Bewusstsein für Qualität zu schaffen.
Fairness heißt für uns also nicht, perfekte Lösungen zu versprechen, sondern in jedem Bereich die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen – technisch, sozial und ökologisch.
Wohin soll die Reise mit MARO.COFFEE gehen. Welche nächsten Schritte oder Produkte stehen bereits in den Startlöchern?
Unsere Reise mit MARO ist noch ganz am Anfang. Aktuell konzentrieren wir uns vor allem auf unser Kernprodukt – die kontinuierliche Weiterentwicklung der Software, den Ausbau des Vertriebs und alles, was rund um die Model 1 passiert. Unser Ziel ist es, die Maschine stetig besser zu machen, neue Features bereitzustellen und das Nutzungserlebnis weiter zu verfeinern.
Parallel arbeiten wir an mehreren Accessories, die in nächster Zeit erscheinen werden. Sie sollen noch mehr Individualität ermöglichen und den experimentellen Charakter der Model 1 weiter fördern – für alle, die Lust haben, mit Kaffee zu spielen und Neues auszuprobieren.
Langfristig wollen wir mit MARO einen nachhaltigen, wirkungsvollen Beitrag zum Specialty-Markt leisten. Wir wünschen uns mehr Innovation, mehr Mut zum Neudenken – und dass Menschen beim Espressozubereiten einfach richtig viel Spaß haben. Wenn wir das schaffen, sind wir auf dem richtigen Weg.
Welche drei Ratschläge würdet ihr jungen Gründer:innen geben, die mit wenig Kapital, aber viel Leidenschaft etwas Eigenes aufbauen wollen?
Erlaubt euch Naivität.
Heutzutage weiß ich viel mehr als am Anfang – und genau das macht mir rückblickend klar, wie wichtig dieses anfängliche Unwissen war. Ohne eine gewisse Naivität wäre MARO wahrscheinlich nie entstanden. Wäre uns die tatsächliche Komplexität dieses Unterfangens zu Beginn bewusst gewesen, wäre es deutlich schwerer, teurer – und vielleicht sogar unmöglich gewesen. Am Anfang geht es nicht darum, alles zu verstehen, sondern überhaupt anzufangen.
Redet offen über eure Vorstellungen und Ziele.
Egal ob mit Zulieferern, Unterstützern, Investoren oder Kunden – eure Ideen, Ansprüche und Visionen machen in dieser Phase alles aus. Es ist wichtig, gemocht zu werden, aber nie auf Kosten des Produkts oder der Idee. Ihr bekommt immer nur das, was ihr kommuniziert. Also springt über euren Schatten und sagt wirklich, was ihr wollt – auch wenn ihr noch nicht genau wisst, ob oder wie es geht. Diese Offenheit schafft Vertrauen und zieht die richtigen Menschen an.
Rechnet regelmäßig – aber verliert euch nicht darin.
Man muss nicht alles durchkalkulieren, bevor man loslegt, aber man sollte lernen, regelmäßig zu rechnen, zu korrigieren und ehrlich zu sich selbst zu sein. In der Anfangszeit fliegt man oft vor Energie, und 20-Stunden-Tage fühlen sich leicht an. Aber wer dabei vergisst, dass später Fixkosten, Mitarbeiter oder Werkzeuge dazukommen, riskiert die eigene Überlebensfähigkeit. Rechnen ersetzt nie das Machen – aber Machen ohne Rechnen wird irgendwann gefährlich.
Bild Gründerteambild @ Credit: MARO Coffee
Wir bedanken uns bei Maximilian Grimm und Robin Kuprat für das Interview
Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder