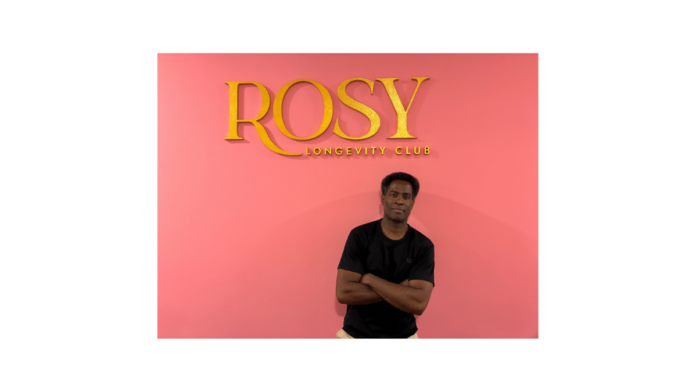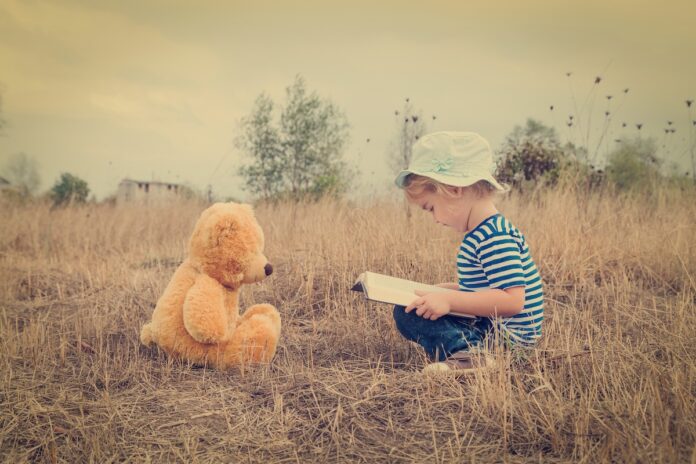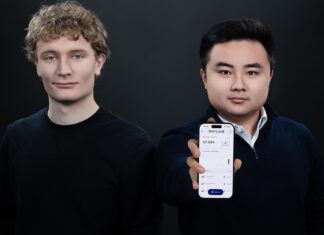Wie würden Sie prepmymeal und die Menschen dahinter denjenigen vorstellen, die Ihr Unternehmen noch nicht kennen?
prepmymeal ist aus einer einfachen Idee entstanden: Gesunde Ernährung sollte nicht kompliziert sein. Wir entwickeln proteinreiche Fertiggerichte, die wirklich schmecken und gleichzeitig das liefern, was der Körper braucht, ohne dass man dafür stundenlang in der Küche stehen muss.
Unser Team weiß, wie es ist, zwischen Arbeit, Sport und Alltag jonglieren zu müssen. Deshalb haben wir Mahlzeiten geschaffen, die nicht nur praktisch sind, sondern auf die man sich auch geschmacklich freuen kann. Unser Ansatz verbindet Lebensmitteltechnologie mit einem klaren Verständnis für die Anforderungen aktiver Menschen: Ob im beruflichen Alltag, beim Training oder in der Regenerationsphase, unsere Gerichte unterstützen gezielt einen gesundheitsbewussten Lebensstil.
Dabei setzen wir auf Transparenz bei den Inhaltsstoffen, durchdachte Nährstoffprofile und einen Geschmack, der sich von industrieller Massenware deutlich abhebt. Jedes Gericht durchläuft einen strukturierten Entwicklungsproess, in dem Nährwert, Haltbarkeit und Genuss gleichermaßen berücksichtigt werden. Keine Kompromisse bei den Zutaten, keine Tricks mit künstlichen Ersatzstoffen, nur ausgewogene Mahlzeiten, die tatsächlich satt und zufrieden machen.
Was uns antreibt? Die Überzeugung, dass gute Ernährung zugänglich sein sollte. Für alle, die sich bewusst ernähren wollen, aber nicht jeden Tag Zeit zum Kochen haben. Mit prepmymeal bekommst du genau das: hochwertige & funktionale Mahlzeiten, die in deinen Alltag passen, unkompliziert, verlässlich und mit echtem Geschmack.
Was hat Sie ursprünglich motiviert, ein Angebot für gesunde und proteinreiche Fertiggerichte aufzubauen?
Die Idee zu prepmymeal entstand aus eigener Erfahrung: Wir alle kennen das Dilemma zwischen gesunder Ernährung und einem vollen Terminkalender. Also haben wir uns den Markt genauer angeschaut und schnell gemerkt, dass proteinreiche Fertiggerichte oft entweder geschmacklich enttäuschen oder ernährungsphysiologisch nicht überzeugen.
Genau hier wollten wir ansetzen. Unsere Motivation war es, Gerichte zu entwickeln, die wir selbst gerne essen würden: nahrhaft, funktional, lecker und ohne Kompromisse bei der Qualität. Mahlzeiten, die den Körper nach dem Training unterstützen, im stressigen Arbeitsalltag satt machen und dabei wirklich gut schmecken.
Wir haben prepmymeal gegründet, weil wir überzeugt sind, dass gesunde Ernährung nicht kompliziert sein muss. Es braucht einfach Produkte, die funktionieren, für Menschen, die sich bewusst ernähren wollen, aber nicht jeden Abend in der Küche stehen können oder wollen.
Welche Vision verfolgt prepmymeal und wie wollen Sie diese in einem wachsenden Convenience Markt erreichen?
Unsere Vision ist klar: Wir möchten die erste Wahl für gesunde und proteinreiche Fertiggerichte sein und dabei die Ernährungsgewohnheiten unserer Kundinnen & Kunden positiv verändern. Wir glauben daran, dass gute Ernährung im Alltag ankommen muss, nicht nur in der Theorie, sondern auf dem Teller. Deshalb entwickeln wir Gerichte, die es unseren Kundinnen & Kunden leichter machen, ihre Ziele zu erreichen: ob mehr Energie im Job, bessere Regeneration nach dem Sport oder einfach das gute Gefühl, sich vernünftig zu ernähren.
Dabei wollen wir nicht nur wachsen, sondern auch vorangehen: mit Produkten, die durch Qualität überzeugen, mit transparenten Prozessen und mit einem nachhaltigen Ansatz, der die Zukunft im Blick behält. Unser Ziel ist es, dass gesunde Ernährung zur selbstverständlichen Wahl für immer mehr Menschen wird.
Wie hat sich der Trend zu gesünderer, proteinreicher Ernährung auf Ihr Geschäftsmodell ausgewirkt?
Der Trend hin zu einer gesunden, proteinreichen Ernährung hat unser Geschäftsmodell maßgeblich beeinflusst und verstärkt. Er hat uns dazu motiviert, unser Produktangebot weiterzuentwickeln und an die steigende Nachfrage nach funktionellen und nährstoffreichen Mahlzeiten anzupassen. Wir haben die Vorteile einer ausgewogenen Ernährung erkannt, sowohl für Menschen mit einem aktiven Lebensstil als auch für diejenigen, die eine gesunde Ernährung in ihren Alltag integrieren möchten. Dieser Trend hat uns auch dazu angeregt, noch mehr auf Nachhaltigkeit und qualitativ hochwertige Zutaten zu setzen, was uns von herkömmlichen Fertiggerichten abhebt.
Welche Zielgruppen greifen besonders häufig zu Ihren Gerichten und welche Bedürfnisse stehen dabei für Sie im Vordergrund?
Unsere Kundinnen und Kunden sind vielfältiger, als man zunächst denken mag: Natürlich sprechen wir Fitness-Enthusiasten an, die gezielt auf ihre Makronährstoffe achten. Aber genauso erreichen wir Berufstätige, die zwischen Meetings keine Zeit für vernünftige Mahlzeiten haben, Eltern, die nach praktischen Lösungen für die ganze Familie suchen, und alle, die sich bewusster ernähren möchten, ohne dafür zum Ernährungsexperten werden zu müssen.
Was diese Menschen verbindet? Sie wollen keine Kompromisse eingehen – weder beim Geschmack noch bei der Qualität, und schon gar nicht bei ihren gesundheitlichen Zielen. Für uns steht deshalb die Balance im Vordergrund: Gerichte, die nährstoffreich sind, gut schmecken und sich unkompliziert in jeden Alltag integrieren lassen. Ob es darum geht, nach dem Sport zu regenerieren, im Job konzentriert zu bleiben oder einfach ein gutes Gefühl beim Essen zu haben – wir wollen Mahlzeiten liefern, die genau das möglich machen.
Was macht Ihre Produkte aus Ihrer Sicht einzigartig im Vergleich zu klassischen Fertiggerichten?
Was prepmymeal unterscheidet, ist unser kompromissloser Ansatz: Wir machen keine Abstriche bei der Qualität und setzen bewusst auf hochwertige, oft auch teurere Zutaten. Während klassische Fertiggerichte häufig auf Kostendruck optimiert werden, gehen wir den umgekehrten Weg, weil wir überzeugt sind, dass man das schmeckt und spürt.
Gleichzeitig optimieren wir unsere Nährwerte gezielt: hoher Proteingehalt, moderate Kalorien und kein zugesetzter Zucker. Damit helfen wir, eines der größten westlichen Gesundheitsprobleme anzugehen – Übergewicht, hohen Zuckerkonsum und die damit verbundenen Folgeerkrankungen. Das ist für uns mehr als ein Produktmerkmal, das ist eine Verantwortung.
Jedes unserer Gerichte entsteht in enger Abstimmung mit Ernährungsexperten. Dabei achten wir darauf, dass nicht nur die Nährwerte stimmen, sondern auch der Geschmack überzeugt. Denn eine Mahlzeit, die zwar gesund ist, aber nicht schmeckt, ist keine Lösung. Unser Anspruch geht über „schnell und praktisch“ hinaus: Wir wollen echte Mahlzeiten liefern, die den Körper unterstützen und auf die man sich freuen kann. Gerichte, die man guten Gewissens isst – weil man weiß, was drin ist und weil sie tatsächlich das halten, was sie versprechen.
Wie gehen Sie mit den Herausforderungen der Skalierung und des hohen Wettbewerbsdrucks im Ready to Eat-Markt um?
Der Ready-to-Eat-Markt ist hart umkämpft und wächst schnell – das wissen wir. Aber genau das spornt uns an, besser zu sein. Statt uns vom Wettbewerb einschüchtern zu lassen, investieren wir gezielt in Produkte, die uns helfen, Qualität und Effizienz zusammenzubringen. Unser Fokus liegt darauf, uns klar zu positionieren: durch Produkte, die wirklich überzeugen, und durch Transparenz in allem, was wir tun. Unsere Kundinnen & Kunden sollen genau wissen, was sie bekommen und warum es sich lohnt, sich für prepmymeal zu entscheiden. Dabei setzen wir nicht auf einmalige Effekte, sondern auf kontinuierliche Weiterentwicklung. Wir hören zu, lernen dazu und passen unsere Produkte an. Immer mit dem Ziel, nicht nur mitzuhalten, sondern voranzugehen. So schaffen wir es, uns von der Masse abzuheben und den steigenden Ansprüchen unserer Kundinnen und Kunden gerecht zu werden.
Welche Rolle spielt TV-Werbung für Markenbekanntheit und das Vertrauen der Konsumenten?
TV-Werbung ist für uns ein neuer Kanal, der bereits nach wenigen Monaten gute Ergebnisse zeigt. Sie hilft uns, unsere Zielgruppen über die bisher dominierende Social-Media-Präsenz hinaus deutlich auszubauen und Menschen zu erreichen, die wir online vielleicht nicht in gleicher Weise ansprechen würden.
Gerade wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen und als Marke sichtbar zu werden, gibt uns TV die Möglichkeit, ein breites Publikum zu erreichen und zu zeigen, wofür prepmymeal steht: für Qualität, Transparenz und echte Mahlzeiten, die in den Alltag passen. In einem Markt, in dem Vertrauen entscheidend ist, können wir so direkt mit Menschen sprechen, nicht nur rational, sondern auch emotional.
Wir wollen zeigen, dass gesunde Ernährung kein Verzicht ist, sondern eine Entscheidung, die sich gut anfühlt und die das Leben leichter macht. Gleichzeitig nutzen wir diese Plattform, um das Bewusstsein für ausgewogene Ernährung zu stärken und zu vermitteln, dass es einfache Lösungen gibt, ohne Kompromisse bei Geschmack oder Qualität.
Unsere Produktpalette entwickeln wir eng mit unseren Kundinnen & Kunden und der Community weiter, immer mit Blick auf das, was wirklich gebraucht wird und was sich in der Ernährungswelt tut. Dabei geht es uns nicht nur um Trends, sondern um echte Alltagstauglichkeit: Gerichte, die gesund und proteinreich sind, sich aber auch schnell und unkompliziert zubereiten lassen. In Zukunft werden wir weiter verstärkt auf individualisierte Ernährungslösungen setzen und gezielt auf spezielle Ernährungsanforderungen und Ziele eingehen – ob Abnehmen, Muskelaufbau, Low Carb, glutenfrei, vegan oder andere Bedürfnisse.
Unser Ziel ist es, noch mehr Menschen anzusprechen, ohne dabei unseren Qualitätsanspruch aufzugeben. Gleichzeitig wollen wir mutig bleiben: neue Geschmackskombinationen ausprobieren, innovative Zutaten einsetzen und Mahlzeiten kreieren, die überraschen. Denn eine gute Ernährung darf nie langweilig werden und die Ansprüche unserer Kundinnen und Kunden werden wir weiterhin ernst nehmen und mit durchdachten Produkten beantworten.
Welche Entwicklungen oder Expansionen plant prepmymeal für die kommenden Jahre?
Wir haben ehrgeizige Pläne für die nächsten Jahre, sowohl bei unseren Produkten als auch geografisch. Aktuell arbeiten wir an der Entwicklung neuer Produktkategorien, um den ganzen Tag unserer Kundinnen und Kunden abzudecken, vom Frühstück bis zum Abendessen und darüber hinaus. Natürlich immer mit dem gleichen Anspruch an Qualität und Nährwert. Parallel dazu expandieren wir weiter in neue Märkte. Nach erfolgreichen Launches in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Italien haben wir für das kommende Jahr weitere Länder im Blick.
Was uns dabei bestärkt: Der globale Trend zu gesunder Convenience ist real, und wir sehen auch in neuen Märkten eine sehr gute Traktion mit unserem Konzept. Die Nachfrage nach hochwertigen, proteinreichen Fertiggerichten wächst nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und darauf wollen wir aufbauen. Unser Ziel ist es, prepmymeal als feste Größe im europäischen Markt zu etablieren und dabei konsequent an unseren Werten festzuhalten: Qualität, Transparenz und echte Mahlzeiten, die den Alltag unserer Kundinnen & Kunden einfacher machen.
Wie wichtig ist Ihnen der Gedanke der Consumer Education gerade im Zusammenhang mit der aktuellen Debatte über Bezeichnungen für pflanzliche oder alternative Produkte?
Consumer Education ist für uns ein sehr wichtiger Aspekt, insbesondere im Hinblick auf die sich wandelnde Ernährungskultur. Wir setzen uns dafür ein, unseren Kundinnen & Kunden fundierte Informationen über die Nährwerte, Zutaten und Vorteile unserer Produkte zur Verfügung zu stellen. Uns ist es wichtig, dass Konsumenten bewusst Entscheidungen treffen können, die ihren Gesundheitszielen und ihrem Lebensstil entsprechen. Klarheit und Transparenz bei der Kennzeichnung von Produkten sind uns dabei ebenso wichtig wie die Aufklärung über gesunde Ernährungsgewohnheiten.
Welche drei Ratschläge möchten Sie Gründerinnen und Gründern geben, die ein Lebensmittel-Startup aufbauen wollen.
Konsumentenorientierung: Lerne deine Zielgruppe wirklich kennen. Nicht oberflächlich, sondern in der Tiefe: Was brauchen diese Menschen tatsächlich? Welche Probleme willst du lösen? Entwickelt Produkte, die echten Mehrwert schaffen, keine Features um der Features willen, sondern Lösungen, die im Alltag spürbar sind.
Qualität und Innovation: Kompromisse bei der Qualität rächen sich früher oder später. Setze von Anfang an auf das Beste, was du liefern kannst und bleibe dabei hungrig. Innovation bedeutet nicht, jeden Trend mitzumachen, sondern mutig zu sein, wo es zählt, und sich dort vom Wettbewerb abzuheben, wo es für deine Kundinnen und Kunden einen Unterschied macht.
Geduld und Ausdauer: Ein Startup aufzubauen ist ein Marathon, kein Sprint. Es wird Rückschläge geben, Momente, in denen nichts so läuft wie geplant. Bleibe geduldig, aber nicht starr. Flexibilität und die Bereitschaft, dazuzulernen und sich anzupassen, sind genauso wichtig wie Durchhaltevermögen. Langfristiges Wachstum entsteht nicht über Nacht, aber mit Konsequenz und der richtigen Balance zwischen Beharrlichkeit und Anpassungsfähigkeit.
Bild: Teambild @ prepmymeal
Wir bedanken uns bei den Gründern für das Interview
Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.